Forum |
News |
Wiki |
Chats |
Portal |
Bilder |
Social Media |
github |
Proxied - Mobile Proxies |
Receive SMS |
Kontakt |
Abuse
Die Seite wird geladen




delle59  Threadstarter iCom Mythos 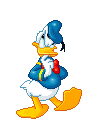 Registriert seit 3 Jahren Beiträge: 4.564 |
Die Nachwehen von Fukushima 170 000 Japaner demonstrieren gegen Atomkraft Vielen gilt Japan als Land des Gehorsams und der Zurückhaltung. Doch die Katastrophe von Fukushima verändert das Land. Immer mehr Japaner gehen gegen Atomkraft auf die Straße – zuletzt demonstrierten mehr als Hunderttausend. 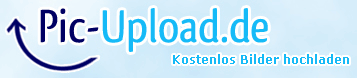 170 000 Menschen demonstrieren am Montag in Tokio gegen Atomkraft „Wir brauchen keine Atomenergie! Gebt uns die Region Fukushima zurück“, rufen die Demonstranten. „Ich will meinen Kindern und Enkeln ein sauberes Japan hinterlassen“, sagt eine protestierende Rentnerin. Der Yoyogi-Park in Tokio ist für gewöhnlich ein Ort der Ruhe und der legeren Freizeitbeschäftigung im hektischen Stadtleben Tokios. Nicht jedoch am Montag, als Menschen aus allen Regionen des Landes in die Hauptstadt gereist waren, um ihrem Ärger Luft zu machen. Die Polizei machte zunächst keine Angabe zur Teilnehmerzahl. Die Veranstalter sprechen von rund 170 000 Teilnehmer, gerechnet hatten sie mit rund 100 000. Der Aufstand gegen Atomlobby und Regierungskungelei ist ein schwer zu übersehender Trend im Land der aufgehenden Sonne. In den vergangenen Monaten wuchs die Zahl der Anti-Atomdemonstrationen immer mehr, etwa bei der erneuten Inbetriebnahme des Reaktors Oi von Betreiber Tepco. Er ist bisher der einzige der 50 Reaktoren, die nach der Katastrophe im März 2011 wieder am Netz sind. Katastrophe „Made in Japan“ Just an dem Tag, an dem Oi wieder ans Netz ging, legte die Untersuchungskommission zum Atomunfall in Fukushima ihren Bericht vor. In vielleicht nie dagewesener Deutlichkeit prangerte man dort die Katastrophe als „Made in Japan“ an. Nicht nur das Krisenmanagement der Regierung habe auf breiter Front versagt, sondern es hätten auch elementare Sicherheitsanforderungen gefehlt. Außerdem seien ausreichende Vorkehrungen für den Ernstfall unterlassen worden. Die Ursachen für die Tragödie lägen noch tiefer: in den „tief verwurzelten Konventionen der japanischen Kultur“. Dazu gehörten der „reflexive Gehorsam“ und „unsere Zurückhaltung, Autoritäten anzuzweifeln“, so die Untersuchungskommission. Auch die Gruppenorientierung der Inselbevölkerung und „unsere Abgeschlossenheit“ werden als weitere fundamentalen Ursachen aufgeführt. Die Atomkatastrophe von Fukushima sei nicht zuletzt eine Folge der Kungelei zwischen der Regierung, der Atomaufsicht und Tepco. Ungeachtet aller Proteste wollen die Betreiber die Reaktoren schrittweise wieder in Betrieb nehmen. Quelle Die Muschi ist kein Grammophon,sie spielt auch keine Lieder, sie ist nur ein Erholungsort für steifgewordene Glieder.
Benutzer die sich bedankt haben: 3
|
| vor 8 Monaten | |
delle59  Threadstarter iCom Mythos 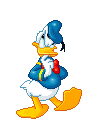 Registriert seit 3 Jahren Beiträge: 4.564 |
Nach Drohung des Chefs Strahlenmessgeräte in Fukushima manipuliert Strahlenmessgerät manipulieren oder der Job ist weg: Mit dieser Drohung soll ein Bauleiter Arbeiter im zerstörten Atomkraftwerk Fukushima dazu gebracht haben, ihre Messgeräte mit Schutzhüllen aus Blei abzudecken. 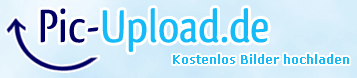 Bei den Aufräumarbeiten im zerstörten Atomkraftwerk Fukushima haben japanischen Medienberichten zufolge mehrere Arbeiter ihre Strahlenmessgeräte manipuliert, um länger in der Anlage bleiben zu können. Bei den Aufräumarbeiten im zerstörten Atomkraftwerk Fukushima haben japanischen Medienberichten zufolge mehrere Arbeiter ihre Strahlenmessgeräte manipuliert, um länger in der Anlage bleiben zu können.Ein leitender Angestellter der Baufirma Build-Up habe bereits im Dezember rund zehn Arbeiter dazu aufgefordert, die Geräte in Bereichen mit hoher Strahlung mit einer Schutzhülle aus Blei abzudecken, berichteten die Zeitung „Asahi Shimbun“ und andere Medien am Samstag. So sollten sie eine niedrigere Strahlung vortäuschen, um ihre Arbeit in der Atomruine fortsetzen zu können. Ministerium will Vorwürfe prüfen Der Bauleiter sagte den Angestellten, dass auch er sein Strahlenmessgerät abgedeckt habe, und riet ihnen ebenfalls dazu, wie mehrere Arbeiter der Zeitung sagten. Ansonsten würden sie schnell den zulässigen Grenzwert von 50 Millisievert pro Jahr erreichen und ihren Job verlieren. Der Zeitung liegt nach eigenen Angaben eine Tonbandaufzeichnung des Gesprächs vor. Einige Arbeiter weigerten sich demnach, die Abdeckung zu benutzen, und kündigten. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo News berichtete, war die Baufirma nach dem Atomunglück im März 2011 von der Betreibergesellschaft Tepco angeheuert worden, um Rohre in einer Wasseraufbereitungsanlage zu isolieren. Das japanische Gesundheitsministerium geht den Vorwürfen nach, wie die Nachrichtenagentur Jiji Press und mehrere Zeitungen berichteten. Für eine Stellungnahme waren das Ministerium und die betroffene Baufirma zunächst nicht zu erreichen. Quelle Die Muschi ist kein Grammophon,sie spielt auch keine Lieder, sie ist nur ein Erholungsort für steifgewordene Glieder.
Benutzer die sich bedankt haben: 1
|
| vor 8 Monaten |
Editiert von delle59 vor 8 Monaten
|
lemonn iCom Süchtling  Registriert seit 3 Jahren Beiträge: 247 |
 |
| vor 8 Monaten |
Editiert von lemonn vor 8 Monaten
|
delle59  Threadstarter iCom Mythos 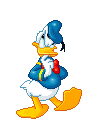 Registriert seit 3 Jahren Beiträge: 4.564 |
Folgen der Katastrophe in Fukushima Radioaktive Strahlung verkrüppelt Schmetterlinge Sie haben deformierte Flügel oder Augen: Schmetterlinge aus der Umgebung des japanischen Atomkraftwerks von Fukushima weisen Missbildungen auf, die sie an ihre Nachkommen weitergeben. 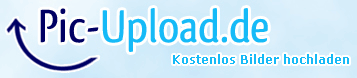 Schmetterlinge aus der Familie der Bläulinge: Links ein Exemplar ohne genetische Veränderungen, rechts ein Schmetterling mit mutierten Flügeln© Joji Otaki/DPA Das Atomunglück von Fukushima hat zu Missbildungen bei Schmetterlingen in der Umgebung des japanischen Atomkraftwerks geführt. Die Radioaktivität in der Nähe des AKW führte noch bei den Nachkommen von Schmetterlingen in dritter Generation zu Gen-Mutationen, wie Wissenschaftler der Ryukyu-Universität in Okinawa herausfanden. Rund zwölf Prozent der untersuchten Schmetterlinge aus der Familie der Bläulinge, die im Larven-Stadium der in Fukushima ausgetretenen Radioaktivität ausgesetzt waren, hatten Missbildungen wie kleinere Flügel oder Deformationen an den Augen. Die Forscher züchteten die Insekten in einem Labor weiter. Dabei zeigten 18 Prozent der Nachkommen ebenfalls Mutationen. In der dritten Generation stieg der Anteil der Tiere mit Missbildungen sogar auf 34 Prozent - obwohl eines der Elternteile jeweils aus einer anderen Population stammte. Sechs Monate nach dem Fukushima-Unglück fingen die Forscher erneut 240 Bläulinge in der Region um das AKW. 52 Prozent von deren Nachkommen wiesen Missbildungen auf. Vor voreiligen Schlüssen wird gewarnt Die Untersuchungen belegten klar, dass die in Fukushima freigesetzte Radioaktivität das Erbgut der Schmetterlinge geschädigt habe, sagte Joji Otaki von der Ryukyu-Universität. Der Wissenschaftler warnte gleichzeitig vor voreiligen Schlüssen: Die Erkenntnisse könnten nicht einfach auf andere Tierarten oder auf den Menschen übertragen werden. Die Forscher planen nun Studien mit anderen Tierarten. Bei dem Erdbeben und einer anschließenden Flutwelle am 11. März 2011 war das AKW Fukushima schwer beschädigt worden. Es kam zur Kernschmelze in drei Reaktoren, große Gebiete wurden radioaktiv verseucht. Es war der schwerste Atomunfall seit der Tschernobyl-Katastrophe 1986. Quelle Die Muschi ist kein Grammophon,sie spielt auch keine Lieder, sie ist nur ein Erholungsort für steifgewordene Glieder.
Benutzer die sich bedankt haben: 5
|
| vor 7 Monaten | |
konversatio Hobby Sauger Registriert seit einem JahrBeiträge: 90 |
Dieser Bericht mit dem Schmetterling ist mit vorsicht zu genießen.
Es ist kein Beweis ein Bild mit einer Mutation bzw. ein vergleich von frischgeschlüften rechts vs. voll entwickelten mit zwei Beinen ausgerissen als Gegenüberstellung zu nennen. Siehe Tschernobyl dort leben nun mehr Tierarten "ohne" Mutation mit angepasstem Erbgut für eine stärkere Strahlenbelastung. Viele Grüße PS: Die breite Bevölkerung 98% hat null Plan. Man soll nicht gegen Atomkraft sein, sondern man könnte gegen Kernfission sein und pro Kernfussion. Das ein Himmel weiter unterschied und würde trotzalledem die Energieprobs lösen. |
| vor 7 Monaten |
Editiert von konversatio vor 7 Monaten
|
KäptNstyle iCom Süchtling 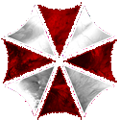 Registriert seit einem Jahr Beiträge: 341 |
Verseuchter Fisch enthält Rekorddosis an Cäsium Im März 2011 bebte die Erde und ein Tsunami überflutete das Akw Fukushima. Seitdem ist die Umwelt verseucht. Jetzt wird bei Fisch eine hohe Cäsiumbelastung festgestellt. Und die Reisernte steht an. Die Zerstörung des japanischen Atomkraftwerks Fukushima Daiichi durch einen Tsunami 2011 hat schwere Folgen auch für die Fischwirtschaft. Im Meer vor Fukushima gefangene Fische weisen Rekordwerte radioaktiven Cäsiums auf. Bei zwei Grünlingen wurden 25.800 Becquerel Cäsium pro Kilogramm gemessen. Das gab der Akw-Betreiber TepCo laut japanischen Zeitungen vom Mittwoch bekannt. Der Messwert entspricht dem 258-Fachen dessen, was der Staat als unbedenklich zum Verzehr einstuft. Die Fische wurden Anfang August in einer Entfernung bis 20 Kilometer von der Atomruine in 15 Metern Tiefe gefangen. Das Fischen vor der Küste der Provinz Fukushima unterliegt freiwilligen Beschränkungen, damit kein kontaminierter Fisch auf den Markt gelangt. Am 11. März 2011 hatten ein schweres Erdbeben und ein Jahrhundert-Tsunami das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi verwüstet. Als Folge kam es zu Kernschmelzen; große Mengen Radioaktivität gelangten in die Umwelt und ins Meer. Zwar hat die Regierung die Lage in der Atomruine für stabil erklärt, dennoch bereiten Strahlenbefunde wie die in den Grünlingen vielen Menschen weiter Sorgen. Im letzten Jahr waren Reisproben verseucht In der im Nordosten Japans gelegenen Provinz, eine der Kornkammern des Inselreiches, steht die Reisernte bevor. Um die Sicherheit zu garantieren, wollen die Behörden laut Medien jeden einzelnen Sack Reis vor der Auslieferung auf Strahlen testen. Im vergangenen Jahr waren in einzelnen Reisproben Cäsiumwerte gemessen worden, die über der vom Staat festgelegten Grenzmarke von 500 Becquerel pro Kilogramm lagen. Ab Oktober wird der Grenzwert landesweit auf 100 Becquerel gesenkt. Die örtlichen Behörden in Fukushima wollen diesen Wert jedoch bereits früher zugrunde legen und jeden Sack Reis aussortieren, der über dieser Marke liegt. Derweil arbeitet die Regierung an einer neuen Energiepolitik und holt hierzu die Meinung von Bürgern ein. Als Option für den künftigen Anteil von Atomstrom an der Energieversorgung des Landes stehen drei Zielmarken für das Jahr 2030 zur Auswahl: ein kompletter Ausstieg, 15 Prozent sowie 20 bis 25 Prozent - verglichen mit 26 Prozent im Jahr 2010. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage nach einer Diskussionsveranstaltung zum Thema sprach sich fast die Hälfte der 290 befragten Bürger für einen Atomausstieg bis 2030 aus. Quelle
Benutzer die sich bedankt haben: 4
|
| vor 7 Monaten |
Editiert von KäptNstyle vor 7 Monaten
|
delle59  Threadstarter iCom Mythos 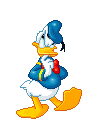 Registriert seit 3 Jahren Beiträge: 4.564 |
Fukushima Roboter soll vertrahlte Fukushima-Ruine erkunden Er soll dorthin gehen, wo kein Mensch hin kann: Der Technologiekonzern Toshiba hat einen Roboter für den Einsatz in der radioaktiv vertrahlten Ruine des japanischen Atomkraftwerks Fukushima entwickelt. Das namenlose Gerät kann sogar Treppen steigen. 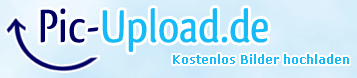 Foto: afp, YOSHIKAZU TSUNO Der japanische Technologiekonzern Toshiba hat einen vierbeinigen Roboter zum Einsatz in der radioaktiv verstrahlten Akw-Ruine von Fukushima entwickelt. Das noch namenlose Gerät soll Aufklärungsmissionen in für Menschen nicht zugänglichem Gebiet fahren, wie Ingenieur Goro Yanase am Mittwoch erklärte. Dabei soll der Roboter steile Treppen und Hindernisse überwinden können. Das 65 Kilo schwere und einen Meter hohe Gerät ähnelt entfernt einem kopflosen Hund und wird per Joystick ferngesteuert. Ausgestattet ist es mit einer Kamera, einem Arm und einem Geigerzähler. Das Gerät, das bisher nur als Prototyp existiert, könne künftig auch mit Arbeitsarmen ausgerüstet werden, um Reparaturen oder Abrissarbeiten auszuführen, sagte Yanase. Bis zu einem möglichen Einsatz in Fukushima seien noch weitere Entwicklungsarbeiten notwendig. Teile des Unglücks-Kraftwerks sind für Menschen nicht zugänglich, weil die Strahlung dort tödlich ist. Fast 19.000 Menschen kamen im März 2011 ums Leben, als ein schweres Erdbeben und ein anschließender Tsunami Japans Nordostküste erschütterten. Die Naturkatastrophe führte zur Kernschmelze in der Atomanlage in Fukushima, der folgenschwersten Atomkatastrophe seit dem Unglück von Tschernobyl 1986. Quelle Die Muschi ist kein Grammophon,sie spielt auch keine Lieder, sie ist nur ein Erholungsort für steifgewordene Glieder.
Benutzer die sich bedankt haben: 5
|
| vor 4 Monaten | |
delle59  Threadstarter iCom Mythos 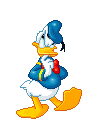 Registriert seit 3 Jahren Beiträge: 4.564 |
Japan erstickt im Atommüll aus Fukushima Zwei Jahre nach der Reaktorkatastrophe leidet das Land noch immer unter den Folgen des GAU. Hunderttausende Müllsäcke mit strahlendem Abfall lagern auf Feldern, in Gärten und sogar auf Schulhöfen. Am 11. März 2011 begann für Japan ein Albtraum. Ein Seebeben der Stärke 9 erschütterte Honshu, löste einen Tsunami aus, der bis zu zehn Kilometer tief ins Landesinnere eindrang und sich in manchen Buchten hochhaushoch auftürmte. 20.000 Menschen starben. Hunderttausende wurden obdachlos. Die Naturkatastrophe zerstörte auch wichtige Teile des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi: In drei Reaktoren kam es zu Kernschmelzen, in zweien zu Explosionen. Die Hülle eines vierten Blocks, in dem ein bis zum letzten Platz gefülltes Brennelementbecken außer Kontrolle geriet, flog in die Luft. In den Stunden und Tagen nach dem Unfall evakuierten die Behörden Menschen im Umkreis von bis zu 30 Kilometern, und in den Wochen und Monaten danach mussten auch noch die Bewohner einiger weiter entfernter Dörfer und Kleinstädte gehen. Schließlich suchten 210.000 Evakuierte in Flüchtlingslagern und bei Verwandten Zuflucht. GAU durch menschliches Versagen Auslöser dieses zweiten GAUs in der zivilen Geschichte der Kernenergie war eine Naturkatastrophe. Die Ursache, so stellten es im Sommer 2012 zwei japanische Untersuchungskommissionen fest, ging tiefer, war "menschliches Versagen": So hätten Betreiber und Aufsichtsbehörden wissentlich Risiken missachtet. Betreiber Tepco gab zu, die Sicherheit der alten Anlagen "sehenden Auges" nicht verbessert zu haben, um jeden Zweifel am Mythos von der absoluten Sicherheit ihrer Kernkraftwerke zu unterbinden: Die Manager fürchteten ein Erstarken der Anti-AKW-Bewegung. Und so sind seit zwei Jahren inzwischen Zehntausende von Menschen damit beschäftigt, die Katastrophe einzudämmen. Anders als in Tschernobyl, wo lediglich ein Reaktor explodierte, stehen am Ufer des Pazifiks gleich vier Havaristen nebeneinander. Das erschwert die Arbeiten. Immerhin ist Block 1 seit einiger Zeit von einer luftdichten, festen Hülle umgeben, damit keine Radioaktivität mehr nach außen dringt. Diese sogenannte Einhausung besteht aus einer Stahlkonstruktion, auf die dann vorgefertigten Kunststoffelemente montiert werden. Block 4 ist derzeit der kritischste An den Blöcken 2 und 3 passiert derzeit nicht sehr viel. Vor allem wird aufgeräumt und überwacht, ob die Kernschmelze, die sich am Boden der Reaktordruck- oder der Sicherheitsbehälter angesammelt hat, auch ausreichend gekühlt wird. Die Aktivitäten konzentrieren derzeit auf Block 4. Der ist momentan der kritischste: Die Explosion vom 15. März 2011 hatte vor allem die unteren Gebäudeteile zerrissen, seitdem ist seine Standsicherheit gefährdet. Zwar wurden Stützen eingezogen, aber niemand kann sagen, ob die einem schweren Beben standhalten. Weil der Block zum Zeitpunkt der Katastrophe wegen einer Revision nicht in Betrieb war, kam es dort zwar nicht zur Kernschmelze. Dafür lagern mehr als 1000 Brennelemente im oberen Gebäudebereich in einem Lagerbecken – derzeit unter freiem Himmel, weil es kein Dach mehr gibt. Ein Korsett soll den Reaktorblock stützen So baut Tepco seit Januar an einer Stützkonstruktion, die die Einhausung von Blocks 4 tragen soll. Die wird, anders als bei Block 1, nur den Gebäudeteil mit dem Lagerbecken umschließen. Für den unteren reiche ein Wetterschutz, so Tepco. Um die Gefahr, die von Block 4 ausgeht, so schnell wie möglich zu beseitigen, lief im Juli 2012 ein Test, bei dem mit Hilfe eines Krans von außen zwei - allerdings neue und damit kaum strahlende - Brennelemente aus dem Becken geholt wurden. Das funktionierte, und so sollen nun ab Ende des Jahres die Brennelemente herausgeholt werden. Die Brennelemente werden unter Wasser in Transportbehälter verladen und per LKW zur weiteren Kühlung in ein ehemals gemeinsam von allen Anlagen am Standort Fukushima Daiichi genutztes Nasslager transportiert. Dort muss aber erst einmal Platz geschaffen werden. Sprich: Die Brennelemente, die darin stehen, müssen in Trockenlagerbehälter verpackt werden, und die kommen derzeit per Frachtkahn im Hafen von Fukushima-Daiichi an. Allein die Anlieferung dieser Lagerbehälter soll zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen. Ungelöstes Problem: der Atommüll Viele Probleme sind ungelöst: Regen- und Grundwasser dringt in die Anlagen ein. Und niemand weiß, wo die Leckagen sind, an denen das hoch kontaminierte Wasser aus den Containments herausläuft. Außerdem ist der Kühlkreislauf immer noch nicht wirklich geschlossenen. Und so werden immer neue Lagerbehälter aufgestellt, wachsen die Wassermengen die dekontaminiert werden müssen – und Umweltschützer fürchten, dass Tepco irgendwann die unrühmliche Praxis wieder aufnehmen könnte, die strahlenden Abwässer ins Meer zu leiten. Ein anderes Problem: der Atommüll, der bei den Aufräumarbeiten auf dem Gelände entsteht. 52.000 Kubikmeter Metall und Beton und 72.000 Kubikmeter Holz sollen, nach Belastung sortiert, an verschiedenen Stellen auf dem Gelände in Zwischenlagern untergebracht werden. Abgeschirmt von der Umwelt werden die dann durch Bodenaushub und Sandsäcke. Die Wälder sollen abgeholzt werden Der Atommüll ist auch außerhalb von Fukushima Daiichi ein riesiges Problem. Die japanische Regierung hat beschlossen, dass die Folgen der Fukushima-Havarie nun überwunden werden sollten. "Im Moment wird überall aufgeräumt und dekontaminiert", erklärt Wolfgang Weiss. Er ist Vorsitzender von UNSCEAR, des Wissenschaftlichen Ausschusses der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der atomaren Strahlung. Es geht um ganze Landstriche, um Städte, Dörfer, Felder, Wiesen, Wälder. Letztere überziehen weite Areale in dem hügelig-bergigen Gelände, und die Regierung hat beschlossen, dass sie alles gründlich machen will: "Die Wälder sollen abgeholzt werden", erzählt Weiss, "aber dadurch wird die Ökologie vollkommen zerstört. Die Landschaft wird danach nicht mehr dieselbe sein." Instabile Hänge sind dann wahrscheinlich noch das kleinste Problem. Derzeit putzen Arbeitskolonnen, Bewohner und Freiwillige das Land: Um die Dosis zu senken, wird Laub entfernt, werden Gebäude abgeschrubbt, die obersten fünf Zentimeter des Bodens mühsam abgekratzt, ebenso die oberste Schicht von Straßen und Wegen. Berge von schwach strahlendem radioaktiven Müll entstehen – und niemand weiß, wohin damit. Denn er darf noch nicht einmal transportiert werden. Atommüll in Plastiksäcken im Garten Allein in der Präfektur Fukushima liegt das Material, in Plastiksäcken verpackt, in mehr als 5000 Behelfslagern. Dazu kommen Hunderttausende von Müllsäcken in Gärten oder auf Feldern, in denen die Bürger den radioaktivem Abfall einsammeln. Selbst auf Schulhöfen: "Die Leute dekontaminieren Schulen in Eigenregie, aber Ihnen wird verboten den Abfall außerhalb des Geländes zu deponieren. Also verscharren sie den dann irgendwo," beschreibt Wolfgang Weiss. Kein Wunder, dass es auch Probleme mit illegaler Müllbeseitigung gibt: Immer wieder werden Fälle bekannt, wo der strahlende Abfall einfach im nächsten Fluss oder Wald verschwindet. Deshalb stellte der Vorsitzende des Wiederaufbaukomitees von Fukushima Hiroshi Suzuki in einem Interview fest, dass die Dekontaminierung um jeden Preis ein Hindernis darstelle: Es fehle Koordination und Überwachung, und die meisten der Beteiligten seien einfach unerfahren. Dabei denkt die Regierung seit fast zwei Jahren darüber nach, wie solche Zwischenlager denn aussehen müssten. Ihre Schlussfolgerung: Es sollten spezielle Deponien sein, von doppelten Betonmauern und einer dicken Lage Bentonit umgeben, ein sehr quellfähiges Tonmineral, das die Umwelt zusätzlich vor dem Inhalt dieser "Betonschüssel" schützen soll. Rundherum abgeschottet soll dann Boden die Deponie bedecken. Bakterien sollen bei der Dekontamination helfen Das Problem sind die anfallenden Müllmassen. Diverse Forschungsprojekte laufen, um diese Massen zu reduzieren. Beispiel: Böden und organisches Abfälle. Mal sollen wärmeliebende Bakterien das Problem lösen, indem sie kontaminierten Blätter verdauen, ein anderes Mal soll Dampf das Radiocäsium aus dem Aushub waschen. Auch für Beton gibt es Ideen: Nano-Bläschen sollen das Radiocäsium herauswaschen. Alle diese Methoden scheinen zu funktionieren. Billig sind sie auch. Allerdings ist ihr Wirkungsgrad nur mäßig hoch. Der ist besser bei einer Methode, die Böden mit Oxalsäure auflöst und das Cäsium dann durch absorbierendes Material auffängt. Aber dieses Verfahren wäre teuer, und was am Ende herauskommt, ist kein Boden mehr. Welche Methode auch gewählt wird: Es ist ohnehin die Frage, ob die Menschen das Resultat überhaupt akzeptieren. Die Regierung möchte, dass – außerhalb der am höchsten kontaminierten und für viele Jahrzehnte gesperrten Gebiete – möglichst viele der Evakuierten so schnell wie möglich zurück in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Kehren die Evakuierten zurück? Theoretisch könnten die Gebiete freigegeben werden, bei denen die zusätzliche Belastung unter 20 Millisievert (mSv) pro Jahr liegt. Das ist der Grenzwert, der für beruflich Strahlenexponierte gilt. Allerdings wird sich der angesichts der Befürchtungen in der Bevölkerung kaum durchsetzen lassen. Meist streben die Behörden für die erste Runde der Dekontaminierung deshalb 5 mSv pro Jahr über dem Hintergrundniveau an. Danach soll der Wert dann weiter gesenkt werden können, hin zur Zielvorgabe plus 1 mSv pro Jahr. Wo die 5 mSv pro Jahr heute schon unterschritten werden, sollten die Bewohner zurückkehren. Das beträfe rund 22.000 Evakuierte. Aber viele der Betroffenen wollen nicht zurück, sondern sich andernorts ein neues Leben aufbauen: Warum sich einer erhöhten Strahlung aussetzen, wenn das nicht notwendig ist? "Kurzfristig ist dieses eine Millisievert in den kontaminierten Gebieten aber meist nicht realisierbar. Also versucht die Regierung derzeit, die Evakuierten über das Streichen der Kompensation zu zwingen", erklärt Wolfgang Weiss. Vertrauen fördern solche Maßnahmen nicht. Angst auch bei geringer Strahlenbelastung Und so bleiben Unsicherheit und Angst, und zwar nicht nur bei den Evakuierten, sondern auch bei den rund zwei Millionen Menschen, die in den Präfekturen Fukushima und Ibaraki leben und ebenfalls vom radioaktiven Fall-out getroffen wurden – wenn auch in geringerem Maß als in den Evakuierungszonen. Eigentlich bräuchte sich die Menschen in keiner Bevölkerungsgruppe Sorgen zu machen, erklärt Wolfgang Weiss: "Die Expositionsabschätzungen, die uns jetzt vorliegen, sind alle sehr verlässlich, und wir wissen, dass ihre Expositionen sehr niedrig waren", erklärt Wolfgang Weiss. Das gilt auch für die Evakuierten, die meist die Region verließen, ehe die Explosionen die Betonhüllen der Reaktoren sprengte. Die Belastung der Bevölkerung im schlimmsten ersten Jahr lag – den verfügbaren Zahlen zufolge – bei höchstens zehn Millisievert (mSv). Das ist etwa das Vierfache der natürlichen Hintergrundstrahlung in Deutschland. Gesundheitliche Folgen seien bei diesen Werten nicht zu erwarten, so Weiss. Leicht erhöhtes Krebsrisiko Zu diesem Schluss kommt auch die WHO in ihrer ersten Risikoabschätzung. Nur für die am stärksten kontaminierten Gebiete außerhalb der 20-Kilometer-Zone, die erst Wochen nach dem Unfall evakuiert worden waren, sehen die Genfer einen Effekt: Für sie erhöhe sich das lebenslange Krebsrisiko leicht. Es geht um Hotspots wie das Dorf Iitate oder die Kleinstadt Namie. In diesen am stärksten betroffenen Gebieten steige beispielsweise das auf die Lebenszeit berechnete Schilddrüsenkrebsrisiko für Mädchen, die zum Zeitpunkt des Unfalls jünger als ein Jahr waren, um 70 Prozent. Das ist allerdings das relative Risiko. In absoluten Zahlen wirkt es anders: "Statistisch gesehen entwickeln von allen Mädchen dieses Alters 0,75 Prozent im Laufe ihres Lebens Schilddrüsenkrebs. Durch Fukushima kommen 0,5 Prozent hinzu", erklärt Angelika Tritscher von der WHO, die zu den Autoren der Studie gehört. Keith Baverstock von der Universität Ostfinnland in Kuopio ist von dem WHO-Bericht enttäuscht. 117.000 zusätzliche Krebsfälle Einer der Gründe: "Die Abschätzung des gesundheitlichen Risikos der Menschen ist immer nur so gut wie die der Dosen, die ihr zugrunde liegt." Und an der gebe es einiges zu kritisieren. So fürchtet die Ärzteorganisation IPPNW, dass es in Japan zusätzliche 117.000 Krebsfälle durch Fukushima geben wird. Aber selbst die träten über die Jahre hinweg auf und drohten deshalb, in einer normalen epidemiologischen Statistik nicht aufzufallen. Das Problem: Weil ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung im Laufe ihres Lebens an Krebs erkranken, und ein 25 bis 30 Prozent daran sterben, können die Epidemiologen unterhalb von etwa 100 mSv in ihren Statistiken keine Strahlungseffekte erkennen, erläutert Anna Friedl, Strahlenbiologin am Klinikum der Universität München: "Gegenüber diesem hohen, normalen, spontanen Risiko noch ein paar zusätzliche Fälle, die durch eine sehr geringe Strahlung dazu kommen, das kann man überhaupt nicht statistisch herausfiltern." Das sollte jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass Japan in den Wochen nach dem 11. März 2011 Glück gehabt hat: "Hätte der Wind nicht fast 80 Prozent des Fall-outs von Fukushima auf den Pazifik hinaus getrieben, hätten die Konsequenzen vielleicht schlimmer sein können als die Tschernobyls", urteilt Keith Baverstock. Die psychischen Folgen der Katastrophe Denn anders als bei der Reaktorhavarie von Tschernobyl gab es keinen Graphitbrand, der die Radionuklide wie ein riesiger Schonstein hoch hinauf in die Atmosphäre hätte tragen und über ein weites Gebiet verteilen können: Der gesamte Fall-out hätte sich auf Honshu konzentriert – und Tokio, die größte Stadt der Welt, liegt weniger als 200 Kilometer entfernt. Bei den psychischen Folgen der Katastrophe spielt der "gnädige Wind" jedoch keine Rolle: Genau wie bei Tschernobyl werden sie von Regierungen und Behörden unterschätzt. Wie groß die Verunsicherung der Menschen ist, belegen erste Untersuchungsergebnisse des Medical Health Survey, mit dem die japanische Regierung die Gesundheitsfolgen des Unfalls bei zwei Millionen Menschen verfolgen lässt. "Etwa die Hälfte einer Kohorte von Tepco-Arbeitern zeigen sehr starke Symptome der Depression und Verzagtheit, und in der Bevölkerung gibt es ähnliche Hinweise", ist da zu lesen. Ein Fünftel der Evakuierten ist traumatisiert. Werte, wie sie bei den Überlebenden des Terroranschlags auf das World-Trade-Center auftreten. Japan setzt weiter auf Atomstrom Trotzdem möchte die neue japanische Regierung zurück zum Atomstrom. Derzeit laufen nur zwei der 50 Anlagen des Landes. Die anderen sollen wieder ans Netz gehen – nach erfolgreich bestandenen Sicherheitsüberprüfungen, versichern die Verantwortlichen. Allerdings könnte sich das bis nach den Wahlen zum japanischen Oberhaus hinziehen. Einmal, weil die Regierung dort noch keine Mehrheit hat, und zum anderen, weil es im heißen Sommer zu Engpässen in der Energieversorgung kommen kann. Nach seinem Wahlsieg im Januar hatte der Ministerpräsident Shinzo Abe sogar verkündet, dass Japan den Anteil der Atomkraft an seiner Energieversorgung möglicherweise sogar erhöhen könnte: Der Bau neuer Atomkraftwerke sei eine Option. Quelle Die Muschi ist kein Grammophon,sie spielt auch keine Lieder, sie ist nur ein Erholungsort für steifgewordene Glieder.
Benutzer die sich bedankt haben: 4
|
| vor 4 Tagen |
 r3st vor 4 Stunden
r3st vor 4 Stunden