Forum |
News |
Wiki |
Chats |
Portal |
Bilder |
Social Media |
github |
Proxied - Mobile Proxies |
Receive SMS |
Kontakt |
Abuse
Die Seite wird geladen




nipi iCom Star 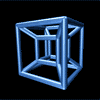 Registriert seit 2 Jahren Beiträge: 858 |
Bundesregierung will Auskunft über IP-Adressen neu regeln
Das Bundeskabinett hat sich am Mittwoch auf einen Gesetzentwurf geeinigt, der die Auskunft über Bestandsdaten wie Name oder Anschrift von Inhabern eines Telekommunikationsanschlusses auf eine neue Rechtsgrundlage stellen will. Erstmals sollen davon ausdrücklich auch dynamische IP-Adressen erfasst sein. Es wird klargestellt, dass Provider die Netzkennungen den Inhabern von Internetzugängen automatisiert zuordnen dürfen – was einen Eingriff ins Fernmeldegeheimnis bedeutet – und die entsprechenden Informationen im sogenannten manuellen Auskunftsverfahren an Sicherheitsbehörden herausgeben müssen. Im heise online vorliegenden Entwurf wird betont, dass die Auskunftspflicht auch für Daten wie PIN-Codes und Passwörter gilt, mit denen der Zugriff auf Endgeräte oder damit verknüpfte Speichereinrichtungen geschützt wird. Dies könnte sich etwa auf Mailboxen oder in der Cloud vorgehaltene Informationen beziehen. Telecom-Anbieter müssen die erwünschten Daten "unverzüglich und vollständig übermitteln". Über derlei Maßnahmen haben sie gegenüber ihren Kunden sowie Dritten Stillschweigen zu wahren. Provider, die über 100.000 Kunden haben, müssen für die Abwicklung der Anfragen zudem "eine gesicherte elektronische Schnittstelle" bereithalten. Dabei sei dafür Sorge zu tragen, dass jedes Auskunftsverlangen durch eine verantwortliche Fachkraft formal geprüft werde. Die vorgeschlagenen Änderungen, denen Bundesrat und Bundestag noch zustimmen müssen, beziehen sich insbesondere auf Paragraph 113 des Telekommunikationsgesetzes (TKG). Zudem soll in die Strafprozessordnung ein Paragraph 100 j neu eingefügt werden. Demnach wäre Auskunft zu erteilen, soweit dies für die Erforschung eines Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsorts eines Beschuldigten erforderlich ist. Darüber hinaus sollen die einschlägigen Gesetze für das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, den Zollfahndungsdienst, den Verfassungsschutz, den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen Abschirmdienst angepasst werden, da Mitarbeiter all dieser Behörden als Auskunftsberechtigte vorgesehen sind. Erforderlich wird die Novelle durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Januar. Karlsruhe hatte die bisherigen Bestimmungen zur Speicherung und Herausgabe von Nutzerdaten, Passwörtern und PINs an Strafverfolger und Geheimdienste als teilweise verfassungswidrig eingestuft. Die Richter hatten etwa befunden, dass Paragraph 113 TKG in seiner jetzigen Form entgegen einer weitverbreiteten Praxis nicht auch für Auskünfte über den Inhaber einer IP-Adresse heranzuziehen ist. Sie gaben dem Gesetzgeber hier bis Juni 2013 Zeit, eine verfassungskonforme Rechtsgrundlage zu schaffen. Das Gericht kassierte zudem die Auskunftspflicht über Zugangssicherungscodes, da diese unverhältnismäßig und nicht mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung vereinbar sei. Die Bundesregierung geht davon aus, dass der Vorstoß, bei dem das Bundesinnenministerium (BMI) federführend ist, nun die von Karlsruhe geforderten "spezifischen Erhebungsbefugnisse in den jeweiligen Fachgesetzen" schafft. Die Anpassung der Landespolizeigesetze bliebe den dortigen Gesetzgebern überlassen. Für die "etwa 16 größten Dienstleister" entstehe durch die Vorschrift zur Einführung der neuen Überwachungsschnittstelle ein zusätzlicher Mehraufwand. Dieser könne aber "durch Einsparungen infolge einer zügigeren und Personalaufwand einsparenden Abwicklung der Auskunftsersuchen kompensiert werden". Ein Sprecher des BMI betonte gegenüber heise online, dass mit der Neufassung keine "neuen Befugnisse für Strafverfolgungs- oder Sicherheitsbehörden geschaffen werden". Es würden allein die erforderlichen eigenständigen Kompetenzen zur Erhebung und Auswertung der Bestandsdaten bei den Diensteanbietern in die einschlägigen Gesetze eingefügt. Eingriffe ins Grundgesetz erfolgten "normenklar", Anforderungen an spezielle Auskünfte würden "unter besonderer Berücksichtigung der damit einhergehenden Grundrechtseingriffe festgelegt". In Providerkreisen wird der Vorstoß dagegen als problematisch eingestuft. Angesichts der Tatsache, dass ein Eingriff in das Fernmeldegeheimnis erfolge, seien nur unzureichende grundrechtssichernde Regelungen enthalten, warnen Branchenvertreter. So sei einerseits die Zahl der abfragenden Stellen nicht überschaubar, anderseits gebe es keine Beschränkung auf bestimmte Delikte. So könne nach Landesrecht eine Vielzahl weiterer Behörden Auskünfte verlangen, um bei Ordnungswidrigkeiten oder zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit tätig zu werden. Sonst übliche Schutzvorkehrungen wie ein Richtervorbehalt oder zumindest eine staatsanwaltliche Anordnung seien nicht vorgesehen. Es sei zu befürchten, dass die Initiative so erneut den Anforderungen des Verfassungsgerichts nicht gerecht werde. Vertreter der Internetwirtschaft sehen Verbesserungsbedarf etwa bei der Auskunftserteilung unter Einschluss von Verbindungsdaten, der Verwendung von Zugriffscodes oder der besonderen Eilbedürftigkeit. Die Schnittstellenklausel bedeute für die betroffenen Unternehmen einen erheblichen finanziellen Aufwand, ohne dass eine Kostenerstattung vorgesehen sei. Die Möglichkeit müsse von den Behörden aber gar nicht genutzt werden, sodass parallel Kapazitäten für die Entgegennahme und Beantwortung von Anfragen vorzuhalten seien. Die vorgesehene Pflicht, Gesuche zu prüfen, bürde den Anbietern zudem ein hohes Haftungsrisiko auf. Quelle "Blues are the root. The rest is the fruit" (Willie Dixon)
Benutzer die sich bedankt haben: 7
|
| vor 5 Monaten | |
Marvin   iCom Zombie  Registriert seit 4 Jahren Beiträge: 2.002 |
Bundesrat nickt schärfere Telefon-Überwachung ab
Die Regierung will das Telekommunikationsgesetz verschärfen, die Polizei soll etwa private Telefon-PIN-Codes erfahren dürfen. Der Bundesrat hat dagegen keine Einwände. Der Bundesrat hat die geplante Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) mit nur kleinen Änderungswünschen durchgewunken. In ihrem Gesetzentwurf hatte die Bundesregierung vor allem gefordert, dass Mobilfunkbetreiber die Daten ihrer Kunden der Polizei nicht mehr nur "im Einzelfall" herausgeben müssen. Das soll automatisch und ohne größere Hürden erfolgen, eine konkrete Gefahr oder ein konkreter Verdacht sollen dafür nicht notwendig sein. Außerdem sollen Internetnutzer leichter identifiziert werden können, da die Provider nun auch mitteilen müssen, wer sich hinter einer sogenannten dynamischen IP-Adresse verbirgt – somit also im Zweifel hinter jeder Kommunikationsverbindung. Beide Vorhaben waren von Bürgerrechtlern wie dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und beispielsweise auch vom Deutschen Journalistenverband kritisiert worden. Die Länderkammer hat diese Punkte des Gesetzentwurfes nun aber nicht mehr bemängelt. Die Ausschüsse des Bundesrates hatten den Entwurf zuvor noch grundsätzlich kritisiert. So hatte sie in ihrer Bewertung geschrieben, dass in dem Gesetzentwurf "nur unzureichende grundrechtssichernde Regelungen eingearbeitet wurden". Außerdem seien die Pläne unverhältnismäßig, sie müssten auf Einzelfälle beschränkt bleiben und es brauche eine "klare Beschränkung auf bestimmte, klar begrenzte Fälle". Nicht verfassungsgemäß Diese Sorgen teilte der Bundesrat in seinem endgültigen Beschluss nicht mehr. Alle drei Kritikpunkte wurden gestrichen. Die Bundesregierung muss das Telekommunikationsgesetz neu regeln, weil das Bundesverfassungsgericht im Januar entschieden hatte, dass die darin vorgesehenen Verfahren zum Abruf der sogenannten Bestandsdaten unverhältnismäßig sind und gegen die Verfassung verstoßen. Das entscheidende Stichwort lautet Bestandsdaten. Beim Telefonieren mit einem Handy werden - grob vereinfacht - zwei Arten von Daten verarbeitet. Eine Datenbank speichert, mit wem sich das Handy verbindet, wie lange das Gespräch dauert, ob es abgebrochen wurde. Also alle Informationen, die direkt mit der Kommunikation zu tun haben. Das sind die sogenannten Verbindungsdaten - die will die Polizei mit dem Vorratsdatenspeicherung genannten Verfahren auswerten. Das hat das Bundesverfassungsgericht ebenfalls untersagt, aber das ist nicht Teil der vorliegenden Novelle. Eindeutig identifizieren In einer zweiten Datenbank speichert der Mobilfunkanbieter, wem das Handy eigentlich gehört und was es im Netz des Anbieters darf, was der Kunde also für Dienste gebucht und bezahlt hat. Das sind die Bestandsdaten. Die sind ebenso umfangreich und privat wie die Verbindungsdaten, gehören dazu doch beispielsweise die Gerätenummer IMSI, eben die PIN zum Freischalten des Gerätes, vor allem aber der Name und die Adresse des Kunden. Die Polizei will mit diesen Daten ermitteln, wem eine bestimmte Rufnummer oder IP-Adresse gehört, die bei einer Kommunikation verwendet wurde. Das geht nur mit den Bestandsdaten. Automatische Datenabfrage ohne Hürden Die geplante Regelung geht dabei weit über die alte hinaus. Obwohl diese vom Verfassungsgericht als zu weitgehend kassiert wurde. So will die Regierung automatische Datenschnittstellen vorschreiben. Alle Anbieter mit mehr als 100.000 Kunden sollen es der Polizei ermöglichen, praktisch auf Knopfdruck solche Daten abzurufen. Das alles, ohne dass ein Richter das genehmigen muss. Und auch ohne klare Grenzen, in welchen Ermittlungsverfahren die Abfrage erlaubt ist und in welchen sie zu weit geht. Der Bundesrat kritisiert dabei nun lediglich, dass laut dem Entwurf die Provider zu prüfen haben, ob eine solche Datenabfrage der Polizei rechtmäßig ist. Denn nicht nur, dass die Bundesregierung mehr Daten für die Polizei will, sie will auch die Arbeit, ob die Abfrage erlaubt ist, den Betreibern auferlegen. Die trügen damit auch das "Risiko einer Fehleinschätzung", so der Bundesrat. Das gehe zu weit, da sich die Provider darauf verlassen können müssten, dass eine Datenabfrage rechtmäßig sei. Es ist der einzige Kritikpunkt, der in der offiziellen Stellungnahme nun noch explizit erwähnt wird. Keine Hürden für Herausgabe der PIN Grundsätzlich hat der Bundesrat aber nichts dagegen, dass solche Abfragen künftig automatisiert erfolgen. Sogenannte Lawful Interception Management Systems - also Schnittstellen zum Auslesen von Kundendaten aus der Datenbank der Betreiber - gibt es schon lange. Mit dem neuen TKG aber sollen sie Vorschrift werden. Er hat auch nichts dagegen, dass im Zweifel die PIN von Handys und die Zugangscodes von Mailpostfächern ohne größere Hürden an die Polizei übergeben werden. Ein Antrag des Landes Schleswig-Holstein, doch wenigstens eindeutige und restriktive Normen zu schaffen, die diese Herausgabe regeln, wurde abgelehnt. Eine Pflicht, dass die Betroffenen von dieser heimlichen Überwachung ihrer privaten Kommunikation benachrichtigt werden müssen, forderte der Bundesrat auch nicht. Diese war ebenfalls in einem Antrag enthalten, der nun ignoriert wurde. Bundestag muss nun entscheiden Verhindert wurde lediglich eine noch weitergehende Verschärfung des Telekommunikationsgesetzes. So hatten der Innen- und der Rechtsausschuss des Bundestages vorgeschlagen, anonyme Prepaid-Karten und anonyme E-Mail-Adressen in Deutschland zu verbieten. Das zumindest lehnte der Bundesrat nun ab. Sinnvoll wäre es sowieso nicht gewesen, wie Kritiker zu Recht bemängeln. Immerhin gibt es solche Accounts und Telefone in anderen europäischen Ländern ohne Probleme. Nach der Stellungnahme des Bundesrates muss als nächstes der Bundestag über den Gesetzentwurf beraten. Einen Termin dafür gibt es noch nicht, allerdings hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die bisherige Regelung nur noch bis Juni 2013 übergangsweise gelten darf. Ab diesem Zeitpunkt muss ein neues Gesetz in Kraft sein. c h a n n e l #3 Reggae | Dub | Lounge | Ambient | Chillout - Google ist kein Freund, aber Du scheinst das nicht zu begreifen! "I actually think most people don't want Google to answer their questions." "They want Google to tell them what they should be doing next." "we know roughly who you are, roughly what you care about, roughly who your friends are." - Eric Schmidt Marvin Minsky isst gern Pommes
Benutzer die sich bedankt haben: 8
|
| vor 3 Monaten | |
delle59  iCom Mythos 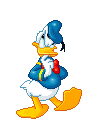 Registriert seit 3 Jahren Beiträge: 4.572 |
Einigung auf Zugriffsregeln für IP-Adressen und Passwörter Die Regierungskoalition hat sich auf Nachbesserungen am umstrittenen Regierungsentwurf zur Neuregelung der Bestandsdatenauskunft verständigt. Kern des heise online vorliegenden Änderungsantrags ist eine klarere Zweckbindung der Befugnis für Strafverfolger, Informationen über Anschlussinhaber wie Name oder Anschrift manuell abzufragen. Darüber hinaus soll der Rechtsschutz für Betroffene ausgeweitet werden. Die SPD-Bundestagsfraktion trägt die Initiative mit. Sachverständige hatten bei einer parlamentarischen Anhörung am Montag moniert, dass der ursprüngliche Vorstoß schwere handwerkliche Fehler aufweise und die Befugnisse des Bundeskriminalamts (BKA) sowie der Bundespolizei massiv in den präventiven Bereich ausdehne. Bestandsdaten sollen daher künftig nur noch "im Einzelfall zum Zweck der Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben" der berechtigten Stellen abgefragt werden. Die Koalition geht damit davon aus, dass der Anwendungsbereich des Instruments "nicht willkürlich ausgeweitet werden kann" und Auskunftsbegehren – den wiederholten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entsprechend – nicht "ins Blaue hinein" gerichtet werden dürfen. Gemäß der Interpretation von Schwarz-Gelb muss mit der Formulierung für Anfragen bei den Providern ein Anfangsverdacht beziehungsweise eine konkrete Gefahr vorliegen. Betroffene sollen zudem von der Maßnahme im Nachhinein in Kenntnis gesetzt werden, solange damit der Zweck der Auskunft nicht vereitelt wird oder einer Benachrichtigung "überwiegende schutzwürdige Belange" Dritter entgegenstehen. Den Zugriff auf PINs, PUKs oder Passwörter will die Koalition nur mit richterlicher Genehmigung zulassen. Wollen Geheimdienste an derlei Codes heran, muss die für sie zuständige parlamentarische G10-Kontrollkommission das absegnen. Zur Begründung führt die FDP-Innenexpertin Gisela Piltz aus, dass solche Informationen "digitalen Wohnungsschlüsseln" entsprächen, die den Weg zu "höchst persönlichen Daten aus quasi allen Lebensbereichen" ebneten. Die Verankerung des Richtervorbehalts stelle so einen "großen Gewinn für den Rechtsstaat", meint Piltz. Praktiker kritisieren dagegen, dass die zuständigen Ermittlungsrichter überfordert seien, nur wenige Minuten zur Prüfung einschlägiger Anträge hätten und diese größtenteils durchwinkten. Wie bei Abfragen rund um IP-Adressen soll mit der Korrektur zudem auch für PINs und Passwörter eine nachträgliche Benachrichtigungspflicht vorgeschrieben werden. Quelle Die Muschi ist kein Grammophon,sie spielt auch keine Lieder, sie ist nur ein Erholungsort für steifgewordene Glieder.
Benutzer die sich bedankt haben: 4
|
| vor 5 Tagen | |
delle59  iCom Mythos 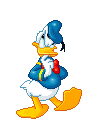 Registriert seit 3 Jahren Beiträge: 4.572 |
Bundestag erlaubt Polizei Abfrage von PIN und Passwörtern Der Bundestag hat das Gesetz über Bestandsdaten verabschiedet. Patrick Breyer klagte erfolgreich gegen das erste Gesetz dazu. Er will nun auch gegen das neue klagen. ---------------------------------------------------- Der Bundestag hat am Donnerstagabend die sogenannte Bestandsdatenauskunft beschlossen - beziehungsweise eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes, in der diese nun neu geregelt wird. Das bedeutet, dass Polizei und Geheimdienste künftig sehr persönliche Informationen von Mobiltelefonbesitzern abrufen dürfen und das automatisiert und ohne größere rechtliche Hürden. Die dabei übersandten Informationen heißen zwar recht harmlos Bestandsdaten. Doch sind sie der Zugang zum Privatleben. Es werden nicht nur Name, Adresse und Kontoverbindung an die Polizei geschickt. Sondern auch die PIN des Handys, Passwörter von E-Mail-Postfächern und Diensten wie Dropbox und dynamische IP-Adressen. Mit denen lässt sich letztlich nachvollziehen, was der Handybesitzer im Netz getan hat. Die Neuregelung des Gesetzes war notwendig geworden, weil das Bundesverfassungsgericht die alte Norm für verfassungswidrig hält. Den ersten Entwurf bewerteten Kritiker als völlig unzureichend, da er die Vorgaben des ursprünglichen Gesetzes sogar noch erweiterte. Die Koalition hatte sich daraufhin auf Nachbesserungen verständigt. Patrick Breyer, der die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht angestrengt hatte, will nun auch gegen das neue Gesetz klagen. "Ich werde auf jeden Fall wieder klagen", sagte er. Er ist überzeugt, dass auch die nun verabschiedete Fassung gegen die Verfassung und gegen das Urteil der Verfassungsrichter verstößt. "Das neue Gesetz ist verfassungswidrig" "Der Gesetzentwurf ist in mindestens sechs Punkten verfassungswidrig", sagte Breyer. Beispielsweise weil er die Datenübermittlung schon erlaubt, wenn die Polizei nur wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt. "Das geht gar nicht." Auch dass bei jeder Kleinigkeit die IP-Adresse herausgegeben und so Internetnutzer identifiziert werden könnten, sei ein Verstoß. Die Beschränkungen für die Geheimdienste seien sogar noch laxer. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, bei dem der Amtsrichter und Piraten-Politiker Breyer Mitglied ist, schreibt dazu: "Entgegen den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts soll die Identifizierung von Internetnutzern durch Geheimdienste keine tatsächlichen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer konkreten Gefahr voraussetzen." Der Arbeitskreis ist mit dieser Meinung nicht allein. Nach Meinung der Kritiker sollten PIN, Passwörter und IP-Adressen überhaupt nur herausgegeben werden, wenn wegen einer schweren Straftat ermittelt wird. Schließlich seien diese Informationen so sensibel wie der Schlüssel zur Wohnung der Betroffenen. Diesen automatisch und nahezu unkontrolliert herauszugeben, sei nicht hinnehmbar. "Die Voraussetzungen, wann die Daten übermittelt werden dürfen, sind völlig unzulässig." Breyer ist sich daher sicher, dass auch das neue Gesetz vom Bundesverfassungsgericht gekippt werden wird. "Die Politiker im Bundestag können nicht ernsthaft glauben, dass es vor dem Gericht Bestand hat." Er hofft, dass es soweit gar nicht kommt. Das Gesetz ist zustimmungspflichtig, der Bundesrat muss darüber abstimmen, bevor es in Kraft treten kann. "Es ist ein realistisches Ziel, dass die Bundesländer den Vermittlungsausschuss anrufen und es dort Nachbesserungen geben wird", sagte Breyer. Wer gegen das Gesetz sei, solle also ruhig an seinen Landesinnenminister schreiben. Quelle Die Muschi ist kein Grammophon,sie spielt auch keine Lieder, sie ist nur ein Erholungsort für steifgewordene Glieder.
Benutzer die sich bedankt haben: 4
|
| vor 4 Tagen |