Forum |
News |
Wiki |
Chats |
Portal |
Bilder |
Social Media |
github |
Proxied - Mobile Proxies |
Receive SMS |
Kontakt |
Abuse
Die Seite wird geladen




nipi iCom Legende 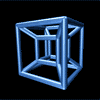 Registriert seit 2 Jahren Beiträge: 963 |
Humboldt-Universität: Studie enthüllt systematisches Doping in der BRD
Organisiertes Doping spätestens seit Beginn der Siebzigerjahre: Eine bisher unveröffentlichten Studie der Humboldt-Universität Berlin belegt laut "Süddeutscher Zeitung" sogar, dass in Westdeutschland mit Steuermitteln geförderte Dopingforschung betrieben wurde. Hamburg - Wie aus einer bisher unveröffentlichten Studie der Humboldt-Universität (HU) Berlin hervorgeht, wurde in der Bundesrepublik Deutschland spätestens seit Beginn der Siebzigerjahre offenbar in zahlreichen Sportarten systematisch und organisiert gedopt. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Demnach sei in dem etwa 800 Seiten umfassenden Bericht 'Doping in Deutschland von 1950 bis heute', der der "SZ" vorliegt, detailliert beschrieben, "in welchem Umfang und mit welcher Systematik zu Zeiten des Kalten Krieges auch in Westdeutschland Doping und Dopingforschung betrieben wurden". "Versuche mit leistungsfördernden Substanzen wie Anabolika, Testosteron, Östrogen oder dem Blutdopingmittel Epo" seien durch staatliche Steuermittel finanziert worden. Die Fäden liefen demnach im 1970 gegründeten Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) zusammen, das bis heute dem Bundesinnenministerium untersteht. Über den konkreten Umfang und die Kosten enthält die Studie der HU aber offenbar keine genauen Angaben. "Den HU-Historikern zufolge verteilte das BISp jedoch allein zehn Millionen D-Mark an die zentralen sportmedizinischen Standorte in Freiburg, Köln und Saarbrücken", schreibt die "SZ". Vordergründig soll es bei den Dopingforschungen laut der Studie um den Nachweis gegangen sein, dass bestimmte Stoffe gar nicht leistungsfördernd seien. War allerdings das Gegenteil der Fall, wurden die Präparate zügig eingesetzt - quer durch zahlreiche Sportarten. Auf Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes hatte das BISp die Studie 2008 selbst in Auftrag gegeben. Im April dieses Jahres wurde sie fertiggestellt. Ob sie veröffentlicht wird, ist aber nicht klar. Das Institut verwies darauf, dass die Publizierung Sache der Wissenschaftler sei. Laut "SZ" fordern diese für eine Veröffentlichung aber Rechtsschutz von ihrem Auftraggeber, da in dem Bericht aktive Funktionäre, Sportler, Ärzte und Politiker belastet werden, die Klagen einreichen könnten. Bisher lehnte das BISp die Forderung der Wissenschaftler aber ab. Laut dem Bericht der "SZ" lassen sich die wichtigsten Erkenntnisse der Studie folgendermaßen zusammenfassen: - Die Ursprünge systematischen Dopings: Gezieltes, systematisches Doping in der Bundesrepublik habe seinen Ursprung im Oktober 1970 mit der Gründung des BISp genommen. Das Institut habe weitreichende Tests veranlasst - die Rede ist von mindestens 516. Getestet wurden demnach einzelne Präparate auf ihre leistungsfördernde Wirkung. Eignete sich ein Mittel zum Dopen, sei es zur Anwendung gekommen. Etwaige Nebenwirkungen sollen den Sportlern verschwiegen worden sein. - Politiker forderten offenbar den Doping-Einsatz: Die deutsche Politik soll Doping nicht nur toleriert, sondern dessen gezielten Einsatz gefordert haben. Der Grund: Sportlicher Ruhm für die Bundesrepublik. In der Studie wird demnach ein Wortwechsel zwischen einem BISp-Funktionär und einem für Sport zuständigen Regierungsmitglied zitiert: "'Von Ihnen als Sportmediziner will ich nur eins: Medaillen in München' [Austragungsort der Olympischen Spiele 1972, Anm. d. Red.]. Da habe ich gesagt: 'Herr Minister: Ein Jahr vorher? Wie sollen wir da noch an Medaillen kommen?' 'Das ist mir egal.'" Um die Forderung zu erfüllen, griff das BISp offenbar auf illegale Stoffe zurück. - Doping-Kontrollen sollen gezielt umgangen worden sein: Mit unterschiedlichen Strategien sollen Institutionen wie das BISp, der Deutsche Sportbund oder das Nationale Olympische Komitee verhindert haben, dass gedopte Athleten enttarnt wurden. Wie die "SZ" unter Berufung auf den Bericht der HU schreibt, seien Sportler angewiesen worden, verordnete Anabolika rechtzeitig vor Wettkämpfen abzusetzen. Zudem soll die Einführung von Trainingskontrollen verzögert worden sein. - Auch der Fußball scheint betroffen: Müssen einige Höhepunkte der deutschen Fußball-Historie neu bewertet werden? Wenn die Erkenntnisse aus dem Bericht stimmen, schon. So sollen Spieler der deutschen Nationalmannschaft bei insgesamt drei Weltmeisterschafts-Endspielen unter Doping-Verdacht gestanden haben. - Minderjährige sollen gedopt worden sein: Nicht nur Spitzen-Athleten sollen illegale Substanzen eingenommen haben, auch Nachwuchssportlern wurden demnach Dopingmittel verabreicht. Von Förder- und Sportklassen voller Minderjähriger ist die Rede, die als Forschungsobjekte gedient haben sollen. Das Ziel: Den Einfluss des Alters auf die Wirkung von Dopingmittel zu testen. Quelle "Blues are the root. The rest is the fruit" (Willie Dixon)
Benutzer die sich bedankt haben: 3
|
| vor 2 Wochen |
Editiert von nipi vor 2 Wochen
|
nipi Threadstarter iCom Legende 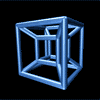 Registriert seit 2 Jahren Beiträge: 963 |
Druck der Öffentlichkeit
Doping-Studie im Netz veröffentlicht Die Geheimniskrämerei um die lange unter Verschluss gehaltene Studie zum Doping in der Bundesrepublik Deutschland hat ein Ende. Auf Druck der Öffentlichkeit ist am Montagnachmittag der brisante Abschlussbericht auf der Homepage des Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp) publiziert worden. Neuer Abschnitt "Die vielfach formulierte These, das Dopingproblem in der Bundesrepublik sei erst mit dem Konsum von Anabolika in den 1960-er Jahren offen zutage getreten, lässt sich jedenfalls eindrucksvoll widerlegen", heißt es in dem 117-seitigen inhaltlichen Abschlussbericht der Berliner Humboldt-Universität. Die Geschichte des Dopings in der Bundesrepublik beginne demnach nicht erst 1970, sondern bereits 1949. Bis 1960 seien im deutschen Sport Amphetamine "systematisch zum Einsatz gekommen". Auch die Elite des deutschen Fußballs hätte die aufputschenden Amphetamine genommen. Donike im Zwielicht Meistens ohne klare Namensnennung wird auch die Mitwisserschaft von damaligen Verantwortlichen im Sport angeprangert. "Es stellt sich mithin die Frage, wie ernsthaft Verantwortliche in der deutschen Sportlandschaft den Kampf gegen das Doping tatsächlich betrieben haben und mit welcher Ausdauer sie die Grundsätze und Ziele in dieser Hinsicht verfolgt haben", heißt es. Namentlich genannt wird der renommierte Doping-Fahnder Manfred Donike. Der inzwischen verstorbene, ehemalige Leiter des Instituts für Biochemie an der Sporthochschule Köln soll laut des Berichts vor den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles bei Absicherungskontrollen im deutschen Team zurate gezogen worden sein. "Ich bin entsetzt, weil es in dem Bericht deutliche Hinweise gibt, dass Manfred Donike Mithilfe geleistet hat, damit gedopte Athleten nicht zu gewissen Wettkämpfen geschickt wurden", sagte der Nürnberger Pharmakologe Fritz Sörgel. Donike galt bis zu seinem Tod 1995 als einer der angesehensten Anti-Doping-Kämpfer der deutschen Sportgeschichte. Keine angemessene Unterstützung durch die NADA Laut Abschlussbericht ist Dopingforschung zum Zwecke der Leistungssteigerung von staatlichen Stellen geduldet und gefördert worden. Staat und Sport-Verbänden seien bis zur Wendezeit schwere Versäumnisse anzulasten. Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) habe die Studie zudem nicht angemessen unterstützt. Die Autoren des 117-seitigen Abschlussberichts der Studie der Humboldt-Universität Berlin kommen zu dem Schluss, anwendungsorientierte Dopingforschung an der Universität Freiburg unter Leitung des Sportmediziners und früheren Olympia-Arztes Joseph Keul sei "von allen entscheidenden Instanzen entweder toleriert oder sogar befeuert" worden. Zwei Lager im DLV? Weiter heißt es, der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) sei in der Anabolika-Frage in mindestens zwei Lager zerfallen. Während die damals beteiligten Sportmediziner (Steinbach, Mellerowicz) sich gegen den Anabolika-Einsatz ausgesprochen haben sollen, soll DLV-Präsident Max Danz, ebenfalls ein Mediziner, gegen die Anwendung nichts einzuwenden gehabt haben. Seiner Aussage nach habe er sich selbst regelmäßig diese Präparate verschrieben. Unterstützung habe Danz durch den bekanntesten und einflussreichsten deutschen Trainer, Karl Adam, erfahren. "Es tobte also hinsichtlich der Anwendung der anabolen Steroide nicht nur ein Kampf zwischen den Athleten, wie unser Projekt für die Phase um 1970 herausgearbeitet hat, sondern auch unter den Funktionären in der Leichtathletik", schreiben die Forscher um Projektleiter Giselher Spitzer. Erschütternder Kampf um Gold Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB ) als Initiator des Projektes und das BISp hatten eine Verzögerung der Veröffentlichung des Abschlussberichts wegen Datenschutzbedenken begründet. "Es ist erschütternd, wie damals um Gold gekämpft wurde. Diese abstrakten Hybridwesen und deren Leistungen, haben für mich keine Bedeutung. Wichtig ist, dass es heute - nicht nur durch mich - möglich ist, annähernd die alten Leistungen zu bezwingen... sauber", sagte Diskus-Olympiasieger Robert Harting. Zweierlei Maß Der ehemalige DDR-Weltklassehochspringer Rolf Beilschmidt forderte mehr Transparenz in der Doping-Aufarbeitung. "Mich überrascht das nicht. Unter uns DDR-Athleten war bekannt, dass auch im Westen gedopt wurde", bemerkte der heutige Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes Thüringen (LSB ). In der Aufarbeitung sei nach der Wende lange mit zweierlei Maß gemessen worden. Kolbe-Spritze weit verbreitet Welchen Stellenwert leistungsfördernde Mittel in den 1970er Jahren in Westdeutschland hatten, zeigte nicht zuletzt auch die sogenannte Kolbe-Spritze. Bei Olympia 1976 sollen rund 1.200 deutsche Athleten die Spritze mit allerdings zumindest damals nicht verbotenen Substanzen erhalten haben. Der Ruderer Peter Michael Kolbe brach im Einer-Finale von Montreal ein, weil er die Spritze nicht vertrug. "Ich habe kurz vor dem Rennen eine Vitamin-Spritze bekommen. Ich führe darauf meine plötzliche Ermüdung kurz vor dem Ziel zurück", sagte Kolbe dem ZDF. Friedrich soll Rede und Antwort stehen Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich soll nach Willen der SPD bei der geplanten Sondersitzung des Sportausschusses des Deutschen Bundestages Rede und Antwort zur pikanten Studie stehen. Wie die SPD am Montag mitteilte, sollen auch der an der Studie beteiligte Giselher Spitzer, BISp-Direktor Jürgen Fischer und DOSB-Präsident Thomas Bach zur Sitzung eingeladen werden. Möglicherweise wollen die Parlamentarier schon am 29. August zusammenkommen, Alternativen sind der 2. oder 3. September. Forderung nach Anti-Doping-Gesetz Clemens Prokop, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV), fordert unterdessen ein Anti-Doping-Gesetz. "Es ist erschreckend, was da bekannt geworden ist", sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Ohne ein entsprechendes Gesetz sei die wirksame Doping-Bekämpfung nicht zu bewerkstelligen. Christian Klaue, Sprecher des Deutschen OlympischenSportbundes (DOSB ), sagte: "Wir begrüßen die Veröffentlichung der Studienergebnisse sehr. Wir werden die Ergebnisse analysieren und Konsequenzen erörtern." Es gibt aber auch Kritik an der Studie. Die deutschen Sportärzte bezweifeln, dass sie wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP), Professor Dr. med. Klaus-Michael Braumann, hatte bereits als Mitglied des Projekt-Beirates seine Bedenken formuliert. Die Studie sei "bekannt, an einigen Stellen banal und habe mit Doping teilweise nichts zu tun", sagte er der Westfalenpost. Quelle Nachtrag: Doping-Studie: Umstrittener Bericht offenbar gekürzt Der Druck der Öffentlichkeit hat gewirkt: Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft hat die brisante Studie zum Doping in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Der Bericht ist allerdings deutlich gekürzt worden - es fehlen laut der "Süddeutschen Zeitung" Namen von einflussreichen Politikern. Hamburg - Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp ) hat am Montag wie angekündigt den Abschlussbericht der Studie "Doping in Deutschland von 1950 bis heute" von der Humboldt Universität Berlin (HU) veröffentlicht. Der inhaltliche Teil umfasst 117 Seiten, auf denen dargestellt wird, dass Dopingforschung in Westdeutschland zum Zwecke der Leistungssteigerung von staatlichen Stellen geduldet und gefördert wurde, Staat und Sport-Verbänden seien bis zur Wendezeit schwere Versäumnisse anzulasten. In dem Sinne sind es keine neuen Erkenntnisse zu dem, was schon bekannt war. Allerdings wirft die Länge des nun veröffentlichten und mit dem 30. März 2013 datierten Abschlussberichts Fragen auf. Nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) ist die ein paar Monate ältere Version, die der "SZ" vorliegt und ebenfalls den Titel "Abschlussbericht" trägt, rund 680 Seiten länger. Es würden zwar "keine grundsätzlichen Thesen" fehlen, dafür aber Details wie Zeitzeugenberichte und "einige Namen, zum Beispiel von einflussreichen Politikern", schreibt die "SZ". Die HU habe den Bericht auf Weisung des BISp eingekürzt. Begründung: Ein Abschlussbericht müsse bestimmte formale Kriterien erfüllen. Derweil hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB ) bekannt gegeben, dass er die Studie von einer neuen Kommission analysieren lässt. Das kündigte DOSB-Präsident Thomas Bach am Abend im "heute journal" des ZDF an. Die Leitung der Kommission soll der frühere Bundesverfassungsrichter Udo Steiner übernehmen. "Die Kommission soll Empfehlungen erarbeiten, wie wir und der deutsche Sport mit den Ergebnissen der Studie umgehen sollen", sagte Bach. Quelle "Blues are the root. The rest is the fruit" (Willie Dixon)
Benutzer die sich bedankt haben: 3
|
| vor 2 Wochen |
Editiert von nipi vor 2 Wochen
|
nipi Threadstarter iCom Legende 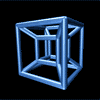 Registriert seit 2 Jahren Beiträge: 963 |
Doping in der BRD: Die verschnupften Helden von 1966
Doping im Fußball - und dann noch in Westdeutschland: Ja, das gab es. Bei drei Spielern der deutschen WM-Elf von 1966 wurden Spuren eines verbotenen Schnupfenmittels gefunden. Konsequenzen hatte das keine. Der DFB weist den Dopingverdacht bis heute zurück. Doping im Westen - das ist spätestens durch die am Montag veröffentlichte Studie der Humboldt-Universität belegt. Dass es das gab, war ohnehin seit längerem bekannt. Aber Doping im Fußball? Auch das. Beides kam offenbar bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1966 zusammen. Eine fast vergessene Geschichte. Die Dopingkontrollen bei jenem WM-Turnier in England waren die ersten in der Historie der Weltmeisterschaften. Sie haben eine Vorgeschichte. Als der dänische Radfahrer Knud-Enemark Jensen bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom vermutlich auch unter Einfluss aufputschender Mittel während des Rennens starb, kam die Dopingproblematik weltweit auf die Agenda. Und 1961 erregte eine Studie großes Aufsehen, die über flächendeckenden Amphetamin-Konsum in der italienischen Profiliga berichtete. Vor diesem Hintergrund beantragte der Fußballverband Uruguays beim Weltverband Fifa, die Spieler während der WM 1962 in Chile zu kontrollieren - und zwar vor dem Anpfiff. Die Fifa lehnte den Vorschlag damals allerdings noch ab. 1965 hatte sich Lage an der Dopingfront noch einmal verändert. Nun gab es eine Erklärung des Europäischen Rates zum Kampf gegen das Doping. Es existierte also politischer Druck, der dafür sorgte, dass die Fifa als einer der ersten Sportfachverbände bei der WM 1966 in England tatsächlich Dopingkontrollen einführte. Auch Beckenbauer musste zum Dopingtest Laut Anti-Doping-Bestimmungen der Fifa wurden nach jedem WM-Spiel je zwei Spieler jeder Mannschaft kontrolliert; geplant war, dass sie per Los "aus einem Hut gezogen werden" sollten. Nach dem WM-Vorrundenspiel der Bundesrepublik Deutschland gegen die Schweiz (5:0) wurde beispielsweise der junge Franz Beckenbauer kontrolliert (er war nicht positiv). Zum Ende des Turniers wurde die Anzahl der getesteten Spieler dann auf drei erhöht. Ausgewertet wurden die Urinproben von Andrew H. Beckett vom Chelsea College of Science and Technology, einem der renommiertesten Amphetamin-Experten der Zeit. Per Kurier wurde dann Mihailo Andrejevic, der Chef der medizinischen Kommission der Fifa, über die Resultate der Analysen informiert. Im Official Report zur WM wurden keine positiven Tests erwähnt. Jener Andrejevic berichtete am 29. November 1966 seinem Kollegen Dr. Max Danz, dem Präsidenten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), vom Ablauf der Pionierarbeit. Alles hätte sehr gut funktioniert, auch die "chromatographischen Laboratoriumsuntersuchungen", so der Jugoslawe. "Feine Zeichen der Einnahme eines gewissen Mittels" Am Ende seines Briefs bemerkte jedoch der Fifa-Funktionär, dass allein bei drei deutschen Fußballern verbotene Substanzen entdeckt worden waren: "Wir hatten nur zum Schluss bei der deutschen Mannschaft bei drei Spielern sehr feine Zeichen von der Einnahme eines gewissen Ephedrinmittels gegen Schnupfen entdeckt. Die Ärzte müssen immer, wenn sie solche Mittel, wenn auch in Spray oder als Nasentropfen geben, darüber Notiz führen." Um welche Spieler es sich handelte, schrieb Andrejevic nicht. Auch nicht, bei welcher Partie die Proben genommen wurden. Es ist zudem nicht klar, was Andrejevic unter "sehr feinen Zeichen" verstand; exakte Dosen oder Messangaben führte er nicht an. Dass es sich aber sportrechtlich um Dopingvergehen handelte, darüber besteht kein Zweifel: Ephedrin stand damals unter dem Punkt 2 ("Drogen der Amphetamine-Gruppe") auf der Liste der verbotenen Medikamente, die damals allen Delegationen vor dem Turnier bekannt gemacht worden war. Von Grenzwerten war nirgendwo die Rede. Insofern waren, sportjuristisch betrachtet, auch "sehr feine Spuren" Doping. Der Hinweis Andrejevic', die Ärzte wären verpflichtet gewesen, über die Verabreichung derartiger Mittel Notizen zu führen, lässt dieses vermuten: Der deutsche Mannschaftsarzt hatte das Komitee nicht über den Einsatz von ephedrinhaltigen Präparaten informiert. Laut Fifa-Reglement hätte der Spieler aber selbst den Weltverband über "exakte Angaben in Bezug auf den Gebrauch von Medikamenten oder speziellen Behandlungen" aufmerksam machen müssen. Die Aktenlage ist also eindeutig. Ob der Deutsche Fußball-Bund (DFB ) damals informiert wurde, ob womöglich intern darüber diskutiert wurde, ist nicht bekannt. Der DFB erklärte auf Anfrage, zum Thema "Doping in den sechziger Jahren" keinerlei einschlägige Akten bereitzuhalten. Aber als die positiven Fälle bekannt wurden, beauftragte der Verband 2011 ein Gutachten, das zu einem bemerkenswerten Schluss kam: Dass es sich 1966 nicht um Dopingfälle gehandelt habe. Damit wurde das Kapitel zugeklappt. Der DFB verwahrt sich bis heute dagegen, dass man von Dopingfällen sprechen könne. Quelle noch was dazu "Blues are the root. The rest is the fruit" (Willie Dixon)
Benutzer die sich bedankt haben: 1
|
| vor 2 Wochen |
Editiert von nipi vor 2 Wochen
|