Die Seite wird geladen




delle59  iCom Mythos 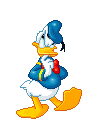 Registriert seit 3 Jahren Beiträge: 4.484 |
800.000 Deutsche können Strom nicht bezahlen Der Ruf nach Rabatten beim Strompreis wird lauter: SPD-Politiker und Verbände wollen einkommensschwache Haushalte unterstützen. Ein aktueller Vergleich zeigt, wo es in Deutschland besonders teuer ist. Mögliche Kostensteigerungen im Zuge der Energiewende haben Forderungen nach einem Strompreisrabatt für einkommensschwache Haushalte verstärkt. Energieunternehmen sollten verpflichtet werden, die ersten 500 Kilowattstunden pro Haushalt zum günstigsten eigenen Tarif anzubieten, fordert SPD-Fraktionsvize Ulrich Kelber in einem Strategiepapier, das er im SPD-Vorstand vorstellen will. Zudem soll es ein Milliarden-Förderprogramm geben, damit zum Beispiel energiesparende Kühlschränke angeschafft werden können. Immer mehr Menschen wird angeblich Strom abgestellt Auch der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen fordert einen Sozialtarif. "Immer mehr Menschen in Deutschland können wegen der seit Jahren überproportional steigenden Preise ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen", sagte der VdK-Landesvorsitzende Udo Schlitt. Ohne Preisnachlässe werde immer mehr Menschen mit niedrigem Einkommen der Strom abgestellt. Daher müssten für alle Stromerzeuger verbindliche Sozialtarife gesetzlich festgelegt werden. Die Strompreise in Hessen seien seit dem Jahr 2005 um 39 Prozent gestiegen, erklärte er seinen Vorstoß. Der Bund der Energieverbraucher dringt auf eine generelle Kostenbefreiung für die ersten 500 Kilowattstunden Strom, die pro Jahr und Haushalt verbraucht werden. Die Befreiung solle für alle Bürger gelten, sagte der Vorsitzende Aribert Peters. Der darüber liegende Verbrauch solle mehr kosten, so dass Normalverbraucher in der Summe ähnlich viel zahlen würden wie bisher und Haushalte mit hohem Verbrauch sogar mehr. Peters sagte, 600.000 bis 800.000 Menschen in Deutschland werde bereits der Strom abgestellt, weil sie ihn nicht mehr zahlen könnten. Mit einem Gutscheinmodell könnten gerade Einkommensschwache entlastet werden und müssten bei 500 Kilowattstunde gratis nicht gleich im Dunkeln sitzen. Die Energiewende sei richtig, so Peters. Atlas zeigt teuerste Orte Den rasanten Anstieg der Strompreise zeigt ein Strompreisvergleich vom Verbraucherportal www.stromauskunft.de. Die Abbildung "Strompreisvergleich Deutschland" zeigt die Veränderung der Strompreise in Deutschland für den Zeitraum Oktober 2011 bis Juni 2012. Grundlage für die Analyse sind die monatlichen Strompreise des lokalen Versorgers bei einem Jahresverbrauch von 2800 Kilowattstunden, wobei Tarife mit Kaution, Vorkasse und einmaligem Bonus nicht berücksichtigt werden. Quelle Die Muschi ist kein Grammophon,sie spielt auch keine Lieder, sie ist nur ein Erholungsort für steifgewordene Glieder. |
| vor 6 Monaten | |
delle59  iCom Mythos 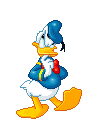 Registriert seit 3 Jahren Beiträge: 4.484 |
Energieversorger kündigt „historischen“ Anstieg an Preisschock zum Jahreswechsel: 2013 droht ein Strompreisrekord Um die Energiewende zu finanzieren, müssen Deutschlands Stromkunden bald noch tiefer in die Tasche greifen: Der Strompreis wird um bis zu elf Prozent steigen – so stark wie in den letzten zehn Jahren nicht. Für Verbraucher bedeutet das rund hundert Euro Mehrkosten pro Jahr. 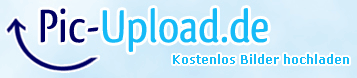 Die Strompreise könnten im kommenden Jahr Rekordhöhe erreichen @dpa Die deutschen Verbraucher müssen im kommenden Jahr mit drastischen Strompreissteigerungen von mindestens sieben Prozent, wahrscheinlich aber zehn Prozent und mehr rechnen. Ein Grund dafür ist, dass die Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien, die auf den Strompreis aufgeschlagen wird, auf ein Rekordniveau von voraussichtlich knapp 5,3 Cent je Kilowattstunde steigen wird. Für einen durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden im Jahr könnten die Förderkosten damit inklusive Mehrwertsteuer von knapp 150 Euro auf fast 220 Euro steigen, errechnete das Verbraucherportal toptarif.de. Eine Großfamilie müsse 2013 sogar 408 Euro brutto bezahlen. Doch das ist nicht alles: Zugleich wird erwartet, dass die Netzentgelte, mit denen der Betrieb, die Wartung und der Ausbau der Stromnetze finanziert werden, stark steigen. Nicht zuletzt bekommen auch immer mehr energieintensive Unternehmen Rabatte bei der Umlage, deren Kosten wiederum den Verbrauchern aufgebürdet werden. Stärkste Erhöhung seit zehn Jahren Im Extremfall drohen Preissteigerungen von elf Prozent, teilte das Portal Verivox.de mit. „Eine Preissteigerung von elf Prozent wäre die stärkste Erhöhung in den letzten zehn Jahren“, sagte Dagmar Ginzel, Energieexpertin bei Verivox. „Die Strompreise steigen jedes Jahr, doch normalerweise bewegen sich die Erhöhungen im einstelligen Prozentbereich.“ Selbst der größte Energieversorger in Ostdeutschland, enviaM, macht keinen Hehl daraus, dass neue Strompreisrekorde nahen: In ganz Deutschland sei ab Januar 2013 mit einem „historischen“ Anstieg zu rechnen, kündigte Vertriebsvorstand Andreas Auerbach an. Der Preis werde um mindestens zehn Prozent höher liegen als heute. Quelle Die Muschi ist kein Grammophon,sie spielt auch keine Lieder, sie ist nur ein Erholungsort für steifgewordene Glieder.
Benutzer die sich bedankt haben: 3
|
| vor 3 Monaten | |
rain iCom Meister Registriert seit 4 Jahren Beiträge: 2.734 |
na, da sieht atomstrom plötzlich gar nicht mehr so schlimm aus, oder?
______________
der swag heiligt die mittel!
Benutzer die sich bedankt haben: 2
|
| vor 3 Monaten | |
nipi iCom Star 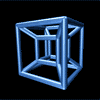 Registriert seit 2 Jahren Beiträge: 774 |
wäre ja nicht so das problem wenn sich die teuerung nur mit den atomaustieg, den ausbau der alternativen energieerzeugung und deren folgen erklären lassen. mindestens 50% der erhöhung dient den e-konzernen zur gewinnsteigerung.
im laufe des jahres 2013 werden die stromriesen dann wieder rekordgewinne verkünden. der bürger übernimmt ja den grossteil der kosten die mit der energiewende anfallen trägt sogar bei einigen vorhaben finanziell das volle risiko und die energiekonzerne streichen die fetten gewinne ein. auch für die energieintensive industrie die ja nicht an den kosten beteiligt wird, soll das extra für sie kreierte energieentlastungs-gesetz/verordnung vorteile haben. diese industrie wurde auch schon vor dem atomausstieg ernergietechnisch subventioniert nach der ernergiewende sogar noch in grösseren masse als davor. auch wenn an der strombörse der strompreis sinkt wird es nicht an den bürger weiter gegeben, nein sogar das gegenteil, der durch die fehlspekulation entgangende gewinn wird auf den strompreis aufgeschlagen. vor 20 jahren oder so als der strompreis sich auch schonmal sehr stark verteuerte aufgrund zugrosser nachfrage hiess es wir müssten stromsparen wenn der strompreis sinken soll also wurde viel strom eingespart in den haushalten. tja pustekuchen das jahr darauf wurde nochmal erhöht diesmal mit der begründung es wurde zu wenig strom verkauft es war unwirtschaflich wegen zu geringer nachfrage man sollte doch mehr strom verbrauchen damit es wieder wirtschaflich wird. wie man es auch dreht der bürger wird immer beschissen und von dieser jetzigen regierung ganz besonders. deutschland steht in der eu auch nur deswegen so gut da weil u.a. der bürger seit vielen jahren permanent zugunsten der industrie und der hochfinanz ausgebeutet wird. "Blues are the root. The rest is the fruit" (Willie Dixon)
Benutzer die sich bedankt haben: 3
|
| vor 3 Monaten |
Editiert von nipi vor 3 Monaten
|
rain iCom Meister Registriert seit 4 Jahren Beiträge: 2.734 |
denke das wäre unter jeder regierungsform ein sehr sensibles thema, schließlich gibts auch gute gründe warum die industrie in deutschland eine besondere regelung hat! ich sehe das aber ähnlich, eine faire beteiligung sollte in allen bereichen möglich gemacht, zumindest individuell nach branchen geprüft werden! im rahmen der bundestagswahlen 2013 würde es mich interessieren, wie speziell die grünen dazu stehen werden und ob sich dazu was vernünftiges in deren wahlprogramm finden lässt...
Zitat:
______________
der swag heiligt die mittel! |
| vor 3 Monaten | |
nipi iCom Star 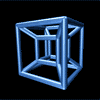 Registriert seit 2 Jahren Beiträge: 774 |
Regierungskommission legt Zwischenbericht vor
Quittung fürs Hü und Hott bei der Energiewende Regierungskommission legt Zwischenbericht vor Quittung fürs Hü und Hott bei der Energiewende Heute wird eine erste Bilanz gezogen. Die Regierungskommission zur Überwachung der Energiewende legt ihren Zwischenbericht vor. Und der wird durchaus kritisch ausfallen. Nicht ganz unschuldig daran ist der Zwist der beiden Bundesminister Altmaier und Rösler. Wirtschaftsminister Philipp Rösler und sein Kabinettskollege Peter Altmaier sind ein ungleiches Paar in ihrer Erscheinung und ihren Prioritäten beim wichtigsten gemeinsamen Regierungsprojekt. Jüngstes Beispiel ist der Streit um die Firmen, die viel Strom verbrauchen, aber wenig Stromsteuer und EEG-Umlage zahlen müssen und deshalb wenig Grund zum Stromsparen haben. Das Rösler-Ministerium hat diesen Vorteil inzwischen etwa 2000 Firmen verschafft. Bundesumweltminister Altmaier möchte die Regel wieder zur Ausnahme machen. Rösler widerspricht: "Das Entscheidende sind nicht die Ausnahmen. Die Ausnahmen machen noch nicht einmal ein Fünftel der jetzt aktuellen Strompreis-Steigerungen mit aus. Sondern der Hauptkostentreiber ist die Förderung der erneuerbaren Energien. Und deswegen müssen wir die ändern." "Es muss viel mehr für die Energieeffizienz getan werden" Die Regierungskommission zur Überwachung der Energiewende wird es beiden heute schriftlich geben. Es müsse viel mehr für die Energieeffizienz getan werden, um den Primärenergieverbrauch bis 2020 im Vergleich zu 2008 wie geplant um 20 Prozent zu senken, befinden die Experten und kritisieren: Stattdessen werde eine aufgeregte und völlig überzogene Debatte um die Strompreis-Entwicklung für Privatkunden zugelassen und forciert. Die Runde um den Vorsitzenden Andreas Löschel vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung lobt zwar den Ausbau der erneuerbaren Energien, der bei der Windkraft an Land am kostengünstigsten sei. Das müsse aber besser mit dem Netzausbau und mit den ambitionierten Ausbauzielen einzelner Bundesländer koordiniert werden. EU-Emissionshandel soll reformiert werden Die Experten mahnen auch eine Reform des EU-Emissionshandels an, dessen Preise in den Keller gefallen sind. Das gefährde nicht nur die Klimaschutzziele der Gemeinschaft, sondern auch die erhofften Einnahmen zur Finanzierung der Energiewende. Umweltminister Altmaier hatte sich in dieser Frage auf die Seite der EU-Kommission gestellt. Sie will die Verschmutzungsrechte in großem Umfang aus dem Markt nehmen, um den Preisverfall zu stoppen. "Es spricht viel dafür, dass wir die Knappheitssignale und das Funktionieren der Märkte nur erreichen können, wenn wir den Überschuss dauerhaft reduzieren", erklärt Altmaier. Bei Philipp Rösler beißt er damit auf Granit: "All diejenigen, die Verknappung fordern, wollen am Ende, dass die Vorhandenen dann teurer werden", sagt der. "Das Teurerwerden zahlt zunächst einmal die Industrie, danach aber die Verbraucherinnen und Verbraucher über ihre Produkte." Rösler sieht im Zertifikatehandel das "einzig funktionierende marktwirtschaftliche System, was wir gerade in dem Bereich haben", und warnt: "Das darf man nicht durch politische Eingriffe kaputtmachen." SPD-regierte Länder blockierten steuerliche Entlastung Wenn Rösler und Altmaier für dieses Hü und Hott heute das schlechte Zeugnis der Regierungsberater empfangen, können sie immerhin auf zwei ganz frische Kabinettsbeschlüsse verweisen: auf den gerade fertig gewordenen Netzentwicklungsplan und auf ein Programm des Bundes zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Dort, wo mit am meisten Energie und CO2 eingespart werden könnte, hatten die SPD-regierten Länder im Bundesrat eine steuerliche Entlastung blockiert. Die Bundesregierung will jetzt auf eigene Faust die schon bestehenden Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau um 2,4 Milliarden Euro aufstocken. Bis 2020 sollen jährlich Zuschüsse von 300 Millionen Euro vor allem an Besitzer selbstbewohnter Wohnungen und Häuser fließen, um Fenster und Heizungen zu modernisieren sowie Wände und Dächer zu dämmen. Quelle "Blues are the root. The rest is the fruit" (Willie Dixon)
Benutzer die sich bedankt haben: 1
|
| vor 3 Wochen | |
HateKate   iCom Zombie Registriert seit 3 JahrenBeiträge: 1.900 |
Scheißegal was die Regierung in Sachen Energiewende unternimmt.
Bezahlen wird es der kleine und der ganzkleine Mann. Aber mann hat mal wieder einige Milliarden an die bedürftige Wirtschaft und die korrupten Energiekonzerne gespendet hintenrum. |
| vor 3 Wochen | |
nipi iCom Star 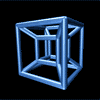 Registriert seit 2 Jahren Beiträge: 774 |
Zwischenbilanz zur Energiewende
Im Schneckentempo auf Zielkurs Man sei auf "Zielkurs", lobt sich die Bundesregierung in Sachen Energiewende. Doch wer genau hinschaut, sieht: Es geht nur dort voran, wo Vorgängerregierungen richtige Entscheidungen getroffen haben, zum Beispiel bei Sonnen- und Windstrom. Eine Analyse. Natürlich gibt es Erfolgsmeldungen in Sachen Energiewende. Der Anteil Erneuerbarer Energien am Stromverbrauch steigt rasant an. Bald wird jede vierte Kilowattstunde aus Wind und Sonne, aus Biomasse und Wasserkraft erzeugt. Auch der Stromverbrauch sinkt, was auf Fortschritte bei der Energieeffizienz hindeutet. Im Griff hat die Regierung die Energiewende aber dennoch nicht. Zwar betont Bundesumweltminister Peter Altmaier immer wieder, dass die Energiewende die wichtigste Herausforderung seit Wiederaufbau und Deutscher Einheit sei. Doch richtig angepackt wurde und wird dieses Megathema von der Regierung bislang nicht. Beim EEG wird die Ernte von Rot-Grün eingefahren Wenn es bei der Energiewende voran geht - zum Beispiel bei Sonnen- und Windstrom - profitiert die schwarz-gelbe Bundesregierung von ihren Vorgängern und dem rot-grünen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aus dem Jahr 2000. Dass dieses EEG an das massive Wachstum der Erneuerbaren Energien angepasst werden muss, steht seit Oktober 2009 im schwarz-gelben Koalitionsvertrag. Wirklich passiert ist seitdem aber nichts. Nun kündigte Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) für März 2013 erst einmal ein Konzept zur EEG-Reform an. Gleichzeitig betonte Umweltminister Peter Altmaier (CDU) aber, der Reformprozess sei so ambitioniert wie eine Gesundheits- oder Rentenreform. Mit anderen Worten: In dieser Legislaturperiode wird das nichts mehr. Stattdessen gab es von Schwarz-Gelb beim EEG in den vergangenen drei Jahren einen ziemlich stümperhaften Zick-Zack-Kurs. Vier Minister in zwei Ressorts verunsicherten wechselseitig eine wichtige Zukunftsbranche. Mehrere Unternehmen der Solar- und Windenergie verloren auch durch diesem unsäglichen Streit das Vertrauen ihrer Geldgeber und mussten Insolvenz anmelden. Weichenstellung beim Netzausbau Gehätschelt werden hingegen jene, die schon vor der Energiewende den Markt zu beherrschen versuchten: Die großen vier Energieversorger und die Netzgesellschaften, die nun maßgeblich bestimmen dürften, welche Stromtrassen durchs Land gezogen werden. 2800 Kilometer neue Hochspannungsleitungen sind geplant. Maßgeblich beteiligt ist die Bundesnetzagentur. Deren Chef ist seit März dieses Jahres Jochen Homann, zuvor Staatssekretär im FDP-geführten Wirtschaftsministerium und aus dieser Zeit eher als Vertreter klassischer Energieversorgungskonzepte bekannt. Viele sehen in der Frage des Netzausbaus eine Richtungsentscheidung. Große Stromautobahnen passen gut zu großen Stromkonzernen. Alternativ könnte man versuchen, mit der Energiewende in möglichst dezentrale Strukturen einzusteigen. Das heißt nicht, dass sich jeder Landkreis und jeder Industriebetrieb komplett autonom mit Energie versorgen soll. Aber das könnte bedeuten, dass man zunächst versucht, den Bedarf durch erneuerbare Energien aus der Nachbarschaft zu decken. Erst wenn das nicht ausreicht, kämen überregionale Stromnetze ins Spiel. Zahlreiche Stadtwerke und Energiegenossenschaften machen sich für eine solche "Energiewende von unten" stark. Und auch die Hälfte der 16 Bundesländer ist nach Worten von Bundeswirtschaftsminister Rösler an einer "Energieautonomie" interessiert. Der Kurs der Bundesregierung ist das aber nicht. Schneckentempo in Sachen Energieeffizienz Kaum Fortschritt auch bei der Energieeffizienz, hier bekämpfte das Rösler-Ministerium im Frühjahr sogar die - alles andere als radikalen - Vorschläge von EU-Energiekommissar Günter Oettinger. Dabei liegt für viele Experten in mehr Energieeffizienz der Schlüssel zum Gelingen der Energiewende. Es ist viel besser einen Liter Sprit einzusparen, als nichts zu sparen und vermeintlichen Biosprit zu tanken. Das gleiche gilt beim Strom: Lieber Kilowattstunden sparen, als einen Ökotarif buchen. Und beim Heizen: Lieber vernünftige Wärmedämmung als eine naturverbundene Holzheizung. Die Einsparmöglichkeiten sind immens, auch in der Industrie. Doch selbst das, was auf kurze Sicht wirtschaftlich lohnend wäre, wird häufig nicht umgesetzt. Dabei könnte die Bundesregierung dafür sorgen, dass wenigstens alles, was neu gekauft und gebaut wird, in Sachen Energieeffizienz Spitze ist, also Elektrogeräte, Häuser und Autos. Aber mit Ausnahme des EU-Glühlampenverbots ist die Bundesregierung mit strengen Vorgaben zurückhaltend. Entweder, weil man die Konsumenten nicht bevormunden will oder zum Schutz alter Industrien, die bei zu hohen Anforderungen um den Absatz ihrer Produkte fürchten. Zukunftsindustrien, die beispielsweise an mehr Effizienz verdienen, haben so Mühe, ihren Markt zu finden. Falscher Fokus auf Strom Ein beliebtes Argument lautet, dass man niemanden durch zu hohe Kosten überfordern dürfe. Es gibt Menschen, die schon jetzt ihre Stromrechnung kaum bezahlen können. Und alles deutet darauf hin, dass Energie teurer wird, ob mit oder ohne Energiewende. Allein schon, weil die fossilen Energieträger, vor allem Öl und Gas, immer schwieriger zu gewinnen sind. Obwohl ins fossile, alte Energiesystem schon riesige Subventionen geflossen sind und immer noch fließen, wird aber kein Staat auf Dauer die Energiepreise künstlich niedrig halten können. Dabei bleibt der Blick merkwürdig auf Strom verengt, auch was die Kosten der Energiewende angeht. Viele ganz durchschnittlich lebende Menschen geben für Benzin und Heizöl zusammen viermal so viel Geld aus wie für Strom. Eine typische Energiekostenrechnung könnte zum Beispiel so aussehen: Tankstelle 1500 Euro, Heizung 1800 Euro, Strom 800 Euro. Doch bei Wärme und Verkehr kommt die Energiewende kaum voran, der Anteil der Erneuerbaren Energien beträgt hier nicht wie beim Strom deutlich über 20 Prozent, sondern nicht einmal die Hälfte davon. Der Nachholbedarf ist riesig, die Herausforderung besonders groß. Denn für viele, deren Lebensstil von Eigenheim und Auto geprägt ist, könnte Energie schon bald zu teuer werden. Doch abgestimmte Strategien zu mehr Energieeffizienz, zu modernem, bezahlbarem Wohnen und zu zukunftsfähiger Mobilität sucht man bei dieser Bundesregierung vergebens. Hier hakt es an allen Ecken und Enden. Fazit: Ziel verfehlt, Zeit nicht genutzt, Zank statt Entscheidung. Quelle "Blues are the root. The rest is the fruit" (Willie Dixon)
Benutzer die sich bedankt haben: 1
|
| vor 3 Wochen | |
HateKate   iCom Zombie Registriert seit 3 JahrenBeiträge: 1.900 |
Und hier mal wieder die neuesten Meldung von der Wahlkampf und Parteienfinanzierungsfront «Spiegel»: Milliardengeschenk für Industrie bei Energiewende Berlin. Die Bundesregierung wird nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» im kommenden Jahr Industriebetriebe in großem Umfang von den gestiegenen Stromkosten befreien. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle habe Mitte Dezember rund 1550 Unternehmen mitgeteilt, dass sie von der sogenannten EEG-Umlage weitgehend ausgenommen seien, schreibt der «Spiegel» in seiner aktuellen Ausgabe. Der wirtschaftliche Vorteil für die Betriebe werde nach Berechnungen der Grünen bis zu vier Milliarden Euro betragen. Entsprechend höher falle die Stromrechnung für Privatkunden und kleinere Unternehmen aus. Nach Angaben des Öko-Instituts sei das vorgebliche Kriterium für die Befreiung - Erhalt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit - in der Mehrzahl der Fälle nicht gegeben. Von der EEG-Umlage umfassend befreit sind laut «Spiegel» auch Kohlegruben der Energiekonzerne RAG und Vattenfall, Schlachthöfe von Wiesenhof und anderen Geflügelmästern sowie Tierfutterfabriken. Profiteure seien zudem regionale Wurst- und Käsehersteller, Schokoladenfabriken, Solar- und Bioenergiefirmen, die Stadtwerke München, der Erdölmulti Exxon und die Bremer Tageszeitungen AG. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte im Oktober angekündigt, die Ausnahmen für Unternehmen bei der EEG-Umlage auf den Prüfstand zu stellen. Es hätten inzwischen mehr Unternehmen eine Befreiung von der Ökostrom-Umlage beantragt als nur die, die im internationalen Wettbewerb stehen, hatte Merkel seinerzeit erklärt. Im Oktober lagen 2000 entsprechende Anträge von Unternehmen vor. (dpa)
Benutzer die sich bedankt haben: 2
|
| vor 2 Wochen | |
nipi iCom Star 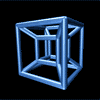 Registriert seit 2 Jahren Beiträge: 774 |
Energiewende
Wo unser Strom in Zukunft herkommen wird Die Energiewende steckt fest. Wegen des Bundestagswahlkampfs werden Entscheidungen aufgeschoben. Doch die Zwangspause hat auch ihr Gutes: Revolutionäre Ideen können zu Ende gedacht werden. In den alten Steinkohle-Schächten des Ruhrgebiets rauschen Wassermassen Hunderte von Metern in die Tiefe. Sie treiben unten im Berg Turbinen zur Stromerzeugung an. In Mecklenburg segeln Skipper auf ringförmigen Seen, in deren Mitte sich zweihundert Meter hohe Kegel wie abgeschnittene Vulkane erheben. Auf deren Rändern drehen sich Windturbinen. Schwärme fliegender Windkraft-Anlagen zerren über der Schwäbischen Alb an ihren Leinen. Sieht so die Zukunft der deutschen Energieversorgung aus? Die politisch vorangetriebene "Energiewende" in Deutschland hat tatsächlich die Macht, das Bild der Kulturlandschaft zu verändern. Denn was wie Science Fiction klingt, wird in Wahrheit längst von deutschen Ingenieuren berechnet, geplant und entwickelt. Die Energiewende: Sie hat im Tüftlerland viel kreatives Potenzial wachgeküsst. Was allerdings aussteht ist die politische Entscheidung darüber, welchen Energie-Technologien wir zukünftig vertrauen, welche wir fördern wollen. Keine Partei gönnt der anderen jetzt einen Erfolg Diese Entscheidung steht jetzt an. Denn die "Energiewende" steckt derzeit im Bundestagswahlkampf fest. Dringend nötige Entscheidungen zur Zukunft des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) liegen auf Eis, weil eine Partei der anderen keinen energiepolitischen Erfolg mehr gönnt. Das Postulat der Ethik-Kommission, wonach die Energiewende ein "nationales Gemeinschaftswerk" sein soll, wird von Regierungskoalition und Opposition in ihrem Ringen um die Macht jetzt erst einmal beiseite geschoben. Dabei braucht der ökologische Umbau der deutschen Energieinfrastruktur dringend eine Kurskorrektur: Wind- und Solarparks werden gebaut, ohne dass es Speicher oder Stromtrassen gäbe. Konventionelle Reservekraftwerke werden in hohem Tempo aus dem Markt gedrängt, ohne dass alternative Grundlast-Lieferanten bereit stünden. Weil es keine Energiespeicher gibt, werden immer mehr hoch subventionierte Windparks abgeschaltet. Schon riegeln Polen und Tschechien ihre Grenzen gegen den aus Deutschland herüberschwappenden Grünstrom ab. Das Blackout-Risiko steigt. Mit immer neuen Subventionen werden die allerorten aufreißenden Probleme gekittet. Die Belastung der Verbraucher nähert sich der Akzeptanzgrenze. Stillstand ermöglicht eine Neuorientierung Die Politik hat die Probleme erkannt: Die Bundesregierung will im Frühjahr eine Debatte über ein neues, besseres Fördermodell für Ökostrom beginnen. Die FDP Sachsen bringt über den Bundesrat demnächst ein "Mengenmodell" ins Spiel, mit dem das Erneuerbare-Energien-Gesetz wieder auf marktwirtschaftlichen Boden gestellt werden könnte. Nur: Politische Mehrheiten, die eine grundlegende Reform gegen die Interessen der Subventionsempfänger durchsetzen könnten, wird es wohl erst lange nach der im September anstehenden Bundestagswahl geben. Der politische Stillstand gibt Zeit zur Neuorientierung, auch in technischer Hinsicht. Sind es noch die richtigen Technologien, die wir mit inzwischen mehr als 20 Milliarden Euro pro Jahr fördern? Oder unterdrückt das Erneuerbare-Energien-Gesetz mit seinen technologischen Festlegungen die Entwicklung innovativer Lösungen für ein funktionierendes, regeneratives Gesamtsystem? Revolutionäre Ideen zur Energiespeicherung Tatsächlich zeigt ein Blick in die Erfinder- und Entwickler-Landschaft, dass es eine Reihe von Ideen gibt, die auf Lösung einiger der wichtigsten Probleme der Ökostrom-Revolution abzielen. Dazu gehören neue Konzepte für die Nutzung der Windkraft, aber vor allem auch neue Vorschläge zur Speicherung des schwankenden und oft am Bedarf vorbei produzierten Ökostroms. Zu solchen Lösungen gehört zum Beispiel die Idee des Ringwallspeichers, die vom süddeutschen Ingenieurbüro Matthias Popp entwickelt wurde. Ringwallspeicher sind künstlich angelegte Seen, die helfen könnten, genügend Speicherkapazität für den temporär anfallenden Ökostrom-Überschuss bereit zu stellen. Das Problem, dass Windstrom vor allem in Norddeutschland anfällt, die großen Stauseen zur Energiespeicherung aber im süddeutschen Bergland sind, könnte so erheblich gemildert werden. In der großen Variante schlagen die Ingenieure einen Ringwall mit 215 Metern Höhe und elf Kilometern Durchmesser vor. Die überschüssige Energie tausender Windkraftanlagen könnte dazu genutzt werden, Wasser aus dem unteren ins obere Speicherbecken zu pumpen. Bei Windflaute und Strombedarf, fließt das Wasser wieder zurück und treibt dabei Turbinen an. Ein künstlicher Speichersee dieser Größe hätte die Kapazität von 700 Gigawattstunden und würde nach den Berechnungen Popps "im Zusammenwirken mit rund 2000 Windenergieanlagen der größten, heute verfügbaren Bauart und der notwendigen Fotovoltaik in der Lage sein, versorgungssicher zwei Kernkraftwerke zu ersetzen." Speicherseen könnten zu Naherholungsgebieten werden Der Beitrag zur Verstetigung des schwankenden Ökostroms sieht nur auf den ersten Blick wie Science-Fiction aus. Sicher: Großprojekte scheitern in Deutschland immer öfter an der fehlenden Akzeptanz der anwohnenden Bevölkerung. Doch tatsächlich ist der Erdaushub und die Abraum-Halde eines Braunkohle-Tagebaus größer, als bei dem Ringwallspeicher, dessen Seen zudem auch als Naherholungsgebiet genutzt werden könnten. Möglich wären außerdem auch mehrere kleine Speicherseen. "Durch Einsatz von weniger als einem Prozent der Landesfläche ließe sich Deutschland allein mit Strom aus Wind und Sonne nachfragegerecht versorgen", hat Entwickler Popp errechnet. Der Flächenbedarf der Speicherseen wäre um einiges geringer als das, was derzeit für den Anbau von Energiepflanzen für die Biogas- und Biokraftstoff-Produktion benötigt wird. Der norddeutsche Energieversorgung Wemag in Schwerin hat bereits eine Studie in Auftrag gegeben, die das Errichten von Pumpspeicherwerken im westlichen Mecklenburg-Vorpommern untersucht. "Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie haben gezeigt, dass es durchaus auch in der Fläche Standorte gibt, an denen Pumpspeicher-Kraftwerke wirtschaftlich errichtet und betrieben werden können", erklärte das Unternehmen auf Nachfrage: "Die Wemag prüft derzeit verschiedene Standorte." "Gerade in Mecklenburg-Vorpommern werden Speichertechnologien dringend gebraucht", sagte Wemag-Chef Thomas Pätzold der "Welt": "In den nächsten drei bis fünf Jahren werden wir in Mecklenburg 100 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien realisieren können." Damit die Energiewende gelinge, "brauchen wir Anlagen, die Strom flexibel speichern und bei Bedarf wieder abgeben können." Polen schließt die Grenze für deutschen Strom Die Frage nach Speichermöglichkeiten für Ökostrom hatte erst in den Tagen vor Weihnachten wieder an Aktualität gewonnen: Der polnische Stromnetzbetreiber PSE Operator kündigte an, die Landesgrenzen künftig gegen unerwünschte Grünstrom-Importe aus Deutschland abriegeln zu wollen. An den beiden großen grenzüberschreitenden Stromtrassen wollen die Polen nun so genannte Phasenschieber bauen: Gewaltige Schaltanlagen, die das polnische Stromnetz vom deutschen trennen können. Überschüssiger Windstrom aus Nordost-Deutschland, der sich bislang seinen Weg über polnische und tschechische Leitungen nach Bayern sucht, staut sich damit in Deutschland auf. Energieexperten wie der Chef der Deutschen Energieagentur, Stephan Kohler, erwarten nun, dass noch häufiger als bisher Windparks auf deutscher Seite zwangsabgeschaltet werden müssen, weil es in Deutschland weder Ökostrom-Speicher noch Stromtrassen zum Abtransport der Kilowattstunden gibt. Dass die Speicherbarkeit von Ökostrom deshalb zur Schicksalsfrage der Energiewende werden könnte, hat man auch im Westen der Republik erkannt. In Nordrhein-Westfalen werden bereits die alten, mehr als 1000 Meter tiefen Bergbauschächte des Kohleschürfers RAG daraufhin untersucht, ob sie künftig als Untertage-Energiespeicher dienen könnten. Konkret geht es um zwei noch aktive RAG-Bergwerke, Prosper Haniel in Bottrop und Auguste Victoria in Marl. Untersucht werden soll, ob diese Zechen nach Abschluss der Kohleförderung 2018 als Energiespeicher umgenutzt werden können. "Ohne Nachnutzung würden die Hohlräume verfallen und nach kurzer Zeit nicht mehr zu Verfügung stehen", sagt Eugen Perau, Leiter des Fachgebiets Geotechnik an der Universität Duisburg-Essen. Speicherbecken in 1000 Metern Tiefe Unterstützt vom Land prüft die Universität nun das Konzept eines "Unterflurpumpspeicherkraftwerks" (UPW). Bei hohem Strombedarf wird Wasser aus einem hoch gelegenen Speicherbecken in die bis zu 1000 Meter tiefen, unterirdischen Speicher auf dem Grunde der Bergwerksstollen abgelassen. Bei einer Überproduktion von Wind- oder Solarenergie wird der überschüssige Strom verwendet, um das Wasser wieder zu heben. "Vielleicht lässt sich noch zusätzlich Energie gewinnen, durch die hohen Temperaturen, die in 1000 Meter Tiefe herrschen, hofft Ulrich Schreiber, Geologe und einer der Initiatoren des Projektes: "Dort unten ist prinzipiell so viel Wärme vorhanden, dass wir Teile des Ruhrgebiet damit beheizen können." "Der Einsatz von Pumpspeicherkraftwerken ist nach aktuellem Stand die ökonomisch günstigste Form der Energiespeicherung", glaubt Udo Paschedag, Staatssekretär im NRW-Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. "Das Schachtsystem im Revier bietet nicht nur ausreichend Platz, sondern auch die erforderlichen Höhenunterschiede, um regenerativ erzeugten Strom zu speichern." Mit 1,3 Millionen Euro will das Bundesland die Forschung unterstützen. Wasser könnte auch in seine Bestandteile zerlegt werden Neben Ringwall- und Untertage-Speichern für Energie werden noch viele weitere Technologien zur Energiespeicherung auf ihre Einsatzfähigkeit und Wirtschaftlichkeit getestet. Viel spricht dafür, dass in Zukunft ein ganzes Bündel unterschiedlicher Technologien dafür sorgt, dass der Strom auch dann fließt, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Weit fortgeschritten sind etwa die Überlegungen, den zur Unzeit produzierten Solar- oder Windstrom zur Elektrolyse zu nutzen. Wasser könnte durch elektrische Energie in Wasser- und Sauerstoff zerlegt werden, wobei ersterer als gasförmiger Primärenergieträger im deutschen Erdgasnetz gespeichert werden könnte. Möglich wäre auch, den so gewonnenen Wasserstoff unter Zugabe von Kohlenstoffdioxid zu "methanisieren", also in Erdgas zu verwandeln. Erste Windparks werden bereits mit Elektrolyse-Anlagen zur Herstellung synthetischen Erdgases ausgerüstet. Andere Konzepte sehen vor, überschüssigen Wind- und Solarstrom in hauseigenen, dezentralen Lithium-Ionen-Batterien zu lagern. Eine vergleichsweise teure und nur kurzfristig wirkende Speicherlösung, die in langen, sonnenarmen Wintermonaten nur begrenzt hilft. Auch eine Renaissance der alten Nachtspeicher-Heizungen wird erwogen – wobei die Geräte diesmal nicht Atomstrom aufnehmen sollen, sondern eben den zu viel produzierten Ökostrom. Gemeinsam haben all diese Technologien vorerst, dass noch ein großes Fragezeichen hinter ihrer Wirtschaftlichkeit steht. Auch die Stromerzeugung wird sich ändern Nicht nur bei der Energiespeicherung tüfteln Visionäre gerade an neuen Methoden, auch die Energiegewinnung könnte sich in den kommenden Jahrzehnten verändern. Ingenieure sehen zum Beispiel in fliegenden Windkraftanlagen ein großes Potenzial. Fliegende Windkraftanlagen produzieren gleichmäßig fast das ganze Jahr hindurch Strom, während die konventionellen Anlagen auf dem Boden häufig unter Flaute leiden. US-Entwickler wie Sky Wind Power oder Makani Power setzen auf helikopterähnliche Konstruktionen, andere auf ringförmige Helium-Ballone, in deren Mitte sich ein Windrad dreht. Das Problem dieser Varianten: Eine relativ schweres Gerät muss in die Luft gebracht und dort gehalten werden. Darunter leidet die Effizienz. Die Brandenburger Ingenieurfirma Enerkite folgt einer anderen Philosophie: Sie lässt alles, was nur irgend möglich ist, am Boden. Deshalb bringt Enerkite lediglich einen Drachen in die Luft, dessen Zugkraft dazu genutzt wird, um mit einem Generator am Boden Strom zu erzeugen. Die Technik befindet sich noch in der Entwicklung, sie ist aber herkömmlichen Windkraftanlagen bereits in vieler Hinsicht überlegen. Der Materialeinsatz beträgt gegenüber Turmbauten nur zehn Prozent, zugleich kommt der EK30 im Vergleich zu Windkraft-Türmen auf eine mehr als doppelt so hohe Betriebsstundenzahl. Bei nachlassenden Winden kann der Drachen durch Leinenzug automatisch wieder in windige Zonen gebracht werden. Die Ingenieure glauben, einen Absturz des Drachens technisch ausschließen zu können. Das Fraunhofer Institut für Windenergie und Systemtechnik (IWES) hat jüngst das Potenzial der "Flugwindkraftanlagen" untersucht. Danach seien drei Prozent der Fläche Deutschlands für den Energiedrachen-Flug geeignet. "Überraschend viel", findet Enerkite-Entwickler Alexander Bormann. Weil die Errichter von turmgestützten Windturbinen Abstandsregeln beachten müssen, kämen die Energiedrachen "pro Flächeneinheit auf die doppelte Energieausbeute" Quelle finde sind paar gute ideen dabei sollte aber eine regierung wie die jetzige das realisieren wird wohl der kleine verbraucher die kosten und das risiko tragen während den e-konzernen dann freundlicherweise erlaubt wird den gewinn einzustreichen. "Blues are the root. The rest is the fruit" (Willie Dixon)
Benutzer die sich bedankt haben: 3
|
| vor 3 Tagen |
 howdy is so fluffy vor 18 Sekunden
howdy is so fluffy vor 18 Sekunden